... newer stories
Freitag, 13. Februar 2004
Faction: Das Rätsel von Neuenburg (2000)
herr denes, 00:37Uhr

Auf der Dorfstraße herrscht nicht viel Verkehr. Mit Schrittgeschwindigkeit biegt ein grün-gelber Traktor in einen Feldweg ein, ein junger Mann putzt die Fenster der Apotheke. Es ist Mittagszeit und auch im Saarland pflegt man, dann eine Ruhepause zu nehmen. Eine gute Gelegenheit zum Schauen. Auf der saftigsten Weide des kleinen Dorfes Neuenburg bei Kaiserslautern steht ein runder Holzschuppen, der gut fünf Meter hoch ist und kein Dach hat. Nähert man sich diesem ungewöhnlichen Bau tagsüber, dann wird man schon nach einigen Schritten von einem der mürrischen Ortsansässigen gestoppt. Jetzt scheint niemand aufzupassen, es ist an der Zeit, dass jemand das Rätsel von Neuenburg löst.
Der fensterlose Bau an der Homburger Straße hat schon ganze Meuten von Lokalreportern beschäftigt. Rudolf Ehrmann von der „Saarland Rundschau“ berichtet von einer „ungewöhnlichen Verschwiegenheit“ unter den sonst redseligen Dorfbewohnern. Er hat sich vor gut zwei Monaten eine Platzwunde am Hinterkopf bei dem Versuch zugezogen, den Schuppen zu begehen. „Das war die Bürgerwehr. Da arbeiten alle Männer des Dorfes“, erklärt Ehrmann. Der Schuppen ist vor einem halben Jahr aufgetaucht, von einem Tag auf den anderen. Beim Grundamt ist die Gemeinde als Besitzer eingetragen. Ehrmann selbst hat keine Idee, was es mit dem Schuppen auf sich hat. Dafür hat er festgestellt, dass seit der Bau 1999 fertig wurde, der finanzielle Wohlstand in Neuenburg spürbar zugenommen hätte. Immer wieder habe er den Bürgermeister und einige Gemeindevorsteher befragt, sie wollten aber nichts dazu sagen. Vor einigen Wochen hätten er und ein Fotograf eine Longitudinal-Beobachtung durchgeführt, dafür haben sie in ihrem Auto Tage und vier Nächte vor dem Holzbau verweilt. „Wir hatten uns extra genug zu essen und zu trinken mitgebracht, weil war ja wussten, dass uns von den Leuten aus dem Dorf niemand was verkaufen würde.“
Ein schneller Satz über den Schwachstromzaun und schon ist man auf der Wiese vor dem Schuppen. Ehrmann geht voraus. „Nicht zu oft umgucken“, empfiehlt er und tut es selbst doch viel zu häufig. Trotzdem hat niemand etwas bemerkt. Die Mittagszeit bietet hier offenbar wirklich die beste Gelegenheit zum Angriff. Die Kleinbildkamera, die Ehrmann auf Hüfthöhe hält, erkennt man nur am mechanischen Klang des Filmrades. „Hier haben die mir damals eins übergebraten“, sagt er hechelnd und setzt trotzdem oder gerade deswegen schnellen Schrittes den Weg zum Schuppen fort. Dort angelangt gilt es zunächst eine Schiebetür zu öffnen, was sich zunächst als schwieriges Hindernis erweist. Ehrmann zieht sein Multifunktionswerkzeug aus seiner Reporterweste und verschmälert dabei seine Augen, als sei er MacGuyver. Tatsächlich gelingt es ihm dann aber auch, die Tür zu öffnen und einen Blick in den Bau zu werfen. Er stößt einen nicht ohne weiteres zu definierenden Laut aus, der nach einer eigenen Observation geradezu schreit. Nichts. In dem Schuppen auf der saftigsten Wiese Neuenburg ist nichts. Wobei „nichts“ auch nicht ganz stimmt, die Weide ist dort so gut gewachsen wie drum herum auch. Hat sich das riskante Manöver nicht gelohnt.
Wenig später, auf der Fahrt nach Saarbrücken zeigt Ehrmann sich frustriert. Ratlos sei er. Obendrein hätte er, noch bis ins Mark schockiert, vergessen, den entscheidenden Anblick –den des Nichts eben- mit der eigens dafür erstandenen Kamera festzuhalten. Die Möglichkeit einer Fotomontage schließt er aus berufsethischen Gründen aus. „Des Scheißding konn misch ma am Asch lecke!“ Das sind vielleicht die feinen Unterschiede zwischen Lokalreporter und einem Autoren mit weiterem Blickwinkel. Ehrmann hat Mängel in der Kombinatorik.
Neuenburg hat 1998 einen saftigen Betrag aus einem EU-Regionalfonds erhalten. In einem Bericht der Wirtschafts- und Strukturkommission aus jenem Jahr ist diese Zahlung als Punkt 245 vermerkt. „Rettungshubschrauber für Gemeindestädte – Ambulanz für die Region“, lautet der dazugehörige Projektname. Für dieses Geld hatten sich seinerzeit der Bürgermeister und der Gemeinderat stark gemacht, entgegen den Empfehlungen der saarländischen Landesregierung. Hintergrund der Kontroverse war ein Streit zwischen der SPD-Landesregierung und dem CDU-Bürgermeister. In Saarbrücken ahnte man wohl bereits, dass ein Rettungshubschrauber nicht gerade zum notwendigsten Inventar der strukturschwachen Region gehörte.
Mit dem Regierungswechsel auf Landesebene geriet jedoch die scharfe Beobachtung der Neuenburger Millionen in den Hintergrund, eine Delegation von EU-Mitarbeitern bekam bei ihrem Besuch im Jahre 1999 lediglich den Rohbau des Holzschuppens zu sehen und das zur Leitzentrale umfunktionierte Büro eines Dorfbewohners. Zufrieden kehrten die spendablen Gäste nach Brüssel zurück, sie hinterließen einen Stapel von Bewertungsbögen, die die Neuenburger regelmäßig ausfüllen und zur Analyse an die entsprechende Abteilung des Regionalfonds schicken sollten.
12,8 Millionen Mark hat Neuenburg für einen Rettungshubschrauber bekommen, den die Gemeinde nie angeschafft hat. Nur ein Bruchteil dieser Summe wurde in zwei neue Notarztwagen investiert, in den verdächtigen Holzschuppen und in eine eigens dafür geschaffene Bürgerwehr. Der Rest, nach unseren Schätzungen etwa 8,5 Millionen Mark dürfte schön säuberlich unter den 4000 Bewohnern aufgeteilt worden sein. Das macht einen Schnitt von 10000 DM pro Neuenburger Familie.
Nur die Beweisführung gestaltet sich in diesem Falle schwierig. Mehrere Anrufe bei zuständigen Stellen der EU wurden nicht beantwortet, von den Neuenburger Provinzbetrüger äußert sich ohnehin keiner und in Saarbrücken will man „mit dieser ganzen Angelegenheit nicht mehr belästigt werden“. Rudolf Ehrmann schrieb seine Reportage über die Auflösung des Rätsels von Neuenburg. Veröffentlicht wurde sie jedoch nicht. Er vermutet, die Liaison der Tochter seines Chefredakteurs mit einem Holzlieferanten aus der Gegend von Neuenburg könnte etwas damit zu tun haben.
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: Stuckmode, Colapulver, Wartehallenflirt
herr denes, 00:33Uhr

.Stuck wird Trend 2004
Eine tolle Modeerscheinung kommt auf uns zu - genauer gesagt: das schrägste Revival der letzten 15 Jahre. Zumindest meinen das die Trend-Päpste von "Look-to-the-y" aus London. Die Modepropheten sprechen von der Rückkehr der Renaissance in Mode, Musik und Wohnungseinrichtung. Da kommt die neue Marktidee eines jungen Griechen ganz richtig. Stavros Nikolaidis hat soeben seine Diplomarbeit an der Münchner Kunsthochschule fertiggestellt und in dieser ein neues Verfahren entwickelt, mit dem aus Haaren und an Fuß- und Fingernägeln Stuck gemacht werden kann. Seine Linie umfaßt galante Rosetten, prunkvolle Ornamente und imponierende Löwen, die besonders als Frisur ihre einmalige Wirkung entfalten sollen. Nikolaidis sagte bei der Modenschau zur Präsentation seines neuen Verfahrens, daß er schon in den nächsten Wochen durch Europa ziehen würde, um talentierte Friseure in dieser Richtung fortzubilden. Er hoffe auf eine flächendeckende Verbreitung von Haar-Stukkateuren, damit auch in unseren Breitengraden das Renaissance-Revival seine richtige Abrundung fände. Zur technischen Realisierung der Kunstwerke aus menschlichen Zellen wollte der Modedesigner nicht viel sagen; er beschrieb allerdings das Verfahren zur Fixierung der klassischen Formen als äußerst umfangreich und versprach eine lange Haltbarkeit der Frisuren.
.Nie mehr Cola-Kästen schleppen!
Wer kein Auto hat und mit anderen Menschen zusammenlebt, kennt ein Problem, das jeden Sommer wieder auftaucht: die elende Schlepperei von Getränkekisten, Paletten mit Bierdosen und einzelnen Flaschen. Oftmals muß man Hunderte Meter zurücklegen, vom Supermarkt bis zum Haus und dann noch in den vierten Stock. Dem europäischen Vertrieb der Coca-Cola AG ist das Leiden der Konsumenten so zu Herzen gegangen, daß das Unternehmen in diesem Sommer erstmals die erfolgreichen Produkte Coke, Sprite, Fanta und Lift in Pulverform anbietet. Weil die Limonaden ohnehin zu 80 Prozent aus Wasser bestünden, könne der Endverbraucher sich die jeweiligen Getränke auch "frisch" zubereiten, sagte der Marketing-Direktor des Unternehmens, Jamie Dawn. Die Preise für den Trockensirup lägen in Bezug auf die herzustellende Menge deutlich unter denen für die bisherigen Flaschenversionen.
.Wartehallenflirt
Die Linzer fahren nicht genug mit Bussen und Straßenbahnen. Das findet nicht nur der Bürgermeister ärgerlich, sondern - natürlich - auch die Stadtwerke. Um mehr Einwohner der Stahlstadt zum öffentlichen Nahverkehr zu locken, startet im Frühjahr ein Versuch, der weltweit seinesgleichen sucht. In den Wartehallen der Bus- und Straßenbahnstationen werden in den nächsten Monaten Bildschirme, Lautsprecher, Mikrophone und Kameras installiert, über die die Wartenden angesprochen werden sollen. Nette Damen für männliche Wartende und charmante Herren für wartende Frauen sollen den ÖPNV-Nutzern die Zeit bis zum Eintreffen des gewünschten Verkehrsmittels verkürzen. "Über das Wetter, die Stadtentwicklung, aber auch über die Stahlwerke und den LASK kann geredet werden", erklärte der Abteilungsleiter "Produktentwicklung/Verkaufsförderung" der Linzer Stadtwerke. Auf die Frage, wie Pärchen und Familien angesprochen werden sollen, konnte er allerdings keine Antwort geben...
... link (0 Kommentare) ... comment
FaktenFiktion nach dem Reh-Lunch.
herr denes, 14:11Uhr
Das neue "FaktenFiktion" finde ich...
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: Der Scheinpoet (2000)
herr denes, 12:32Uhr

Böse Zungen behaupten, Frauen seien nur an Geld interessiert. Aber eigentlich suchen sie auf den Scheinen nur nach der wahren Liebe.
Manche Geschichten drohen an Formalitäten zu scheitern. Wenn man sie hört, ist man berührt, vielleicht läuft einem auch der oft zitierte Schauer über den Rücken, doch spätestens drei Gedanken weiter fragt man sich: "Moment mal, wo ist denn hier der Haken?"
Womit wir radikal das Thema wechseln: Banknoten und Münzen sind Eigentum des Staates, und jeder Mißbrauch ist strafbar. Wer mutwillig Geld zerstört, beschädigt oder zweckentfremdet, dem droht eine Zuchthausstrafe von sechs Monaten bis drei Jahren. So steht es im Gesetz.
Ein 23jähriger Grieche aus Ostwestfalen in Deutschland führt diese beiden Erzählstränge in seiner Position und seinen Aufrißmethoden zusammen. Wir haben ihn interviewt.
FAKTENFIKTION: Georgios, hast du eine Freundin?
Georgios: Ich liebe alle Frauen, wirklich alle.
FAKTENFIKTION: Aber vielleicht eine ganz besonders?
Georgios: Momentan liebe ich neben meiner Mutter und meiner Oma noch mindestens fünf weitere Frauen.
FAKTENFIKTION: Das nennt man Polygamie.
Georgios: Nicht unbedingt. Ich habe keine feste Beziehung; es sind immer die Frauen, die auf mich zukommen. Ich habe keiner etwas versprochen. Mein Schicksal ist, daß ich alle Frauen liebe.
FAKTENFIKTION: Wie schaffst du das?
Georgios: Das ist angeboren. Ich sehe eine Frau und finde sie schön. Ich telefoniere mit einer...
FAKTENFIKTION: Nein, wir wollen gar nicht wissen, weshalb du angeblich alle Frauen liebst, sondern warum sie auf dich zukommen.
Georgios: Oh. Ich bin Dichter. Genauso erfolgreich wie Donna Leon.
FAKTENFIKTION: Man kennt deinen Namen (Nioplis; Anm. d. Red.) aber nicht aus den Bestsellerlisten.
Georgios: Aber viele Menschen haben schon einmal einen Text von mir gelesen. Ich publiziere auf Geldscheinen. Die Notenbank ist mein Verleger, die Banken sind die Buchhandlungen.
FAKTENFIKTION: Auf welchen Scheinen verewigst du Deine Texte?
Georgios: Bisher fast nur auf deutschen und griechischen. Aber zu meiner großen Freude kommt ja bald der Euro.
FAKTENFIKTION: Viel Platz bleibt da aber nicht zum Schreiben, zumindest bei kleineren Werten.
Georgios: Auf den deutschen Zehnmarkschein paßt ein Sonett mit Überschrift und meiner Signatur.
FAKTENFIKTION: Kommen wir zurück zu den Frauen. Was lockt sie denn nun an?
Georgios: Das habe ich doch schon gesagt. Die Texte auf den Geldscheinen.
FAKTENFIKTION: Und wovon handeln die?
Georgios: Sie sind einfach schön. Manche sagen, sie wären belanglos, zum Beispiel, weil sie nur von einer verwelkenden Rose in einem Garten erzählen. Oder weil sie altmodische Floskeln enthalten. Aber - ganz ehrlich: Mich interessiert auch nicht, was Männer dazu meinen.
FAKTENFIKTION: Kannst du ein Beispiel zitieren?
Georgios: Das möchte ich nicht. In Deutschland sind mittlerweile sechshundert Scheine in Umlauf, auf denen man Georgios´ Lyrik lesen kann.
FAKTENFIKTION: Verstehe - wahrscheinlich willst du Nachahmer vermeiden.
Georgios: Richtig. Die Wirkung meiner Texte beruht aber auch und vor allem auf der Situation, in der man sie liest. Zum Beispiel, wenn eine verlassene, traurige Frau sich eine romantische CD kauft, sie mit einem 50-Mark-Schein bezahlt und im Wechselgeld einen von mir beschrifteten Zehner findet.
FAKTENFIKTION: Das ist jetzt aber sehr hanebüchen!
Georgios: Keineswegs. Diese Situation hat schon mehrmals stattgefunden. Ich erhalte von meinen Verehrerinnen immer wieder Rückmeldungen, wie sie an den betreffenden Schein gekommen sind.
FAKTENFIKTION: Wie findet denn die Kommunikation statt?
Georgios: Anfangs stand meine Telefonnummer unter den Gedichten; das war aber wohl zu plump und mir selbst auch zu riskant.
FAKTENFIKTION: Und nun signierst du mit Deiner E-Mail-Adresse?
Georgios: amor@hotmail.com, genau! Das ist geheimnisvoller und schließt in unseren Zeiten keinen mehr aus.
FAKTENFIKTION: Du bist gewissermaßen ein High-Tech-Don Juan. Was sagen denn die Behörden dazu?
Georgios: Bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet. Aber ich tue ja auch keinem was Böses.
FAKTENFIKTION: Nur noch eine Frage: Wie kommst du an so viele Scheine?
Georgios: Ich schreibe einfach auf alle Geldscheine, die mir und meiner Familie unterkommen. Mein Onkel hat gerade an der Börse Erfolg gehabt - da erwarte ich schon meinen nächsten Bestseller!
FAKTENFIKTION: Wir sind gespannt!
Georgios: Danke.
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: Gelüftete Gesellschaft
herr denes, 12:28Uhr

Henkelmann dreht sich auf dem langen, von Neonröhren beleuchteten Gang zweimal um, als wolle er sicher sein, daß uns niemand folgt. Er kratzt sich am Nacken, scheint nervös und sagt: "Scheißmagen!" Als wir im Aufzug angelangt sind, der vermutlich selbst bei seiner Inbetriebnahme in den siebziger Jahren nicht allzu modern wirkte, drückt er - von einem tiefen Stoßseufzer begleitet - auf "K". Nicht besonders schnell gleiten wir in die Tiefe des Krankenversicherungsbaus, der vorbeifahrenden Autofahrern durch die sozialistisch wirkende Buchstabenkombination G E S U N D H E I T aus Leuchtstofflettern auf dem Dach auffällt. Im Keller angelangt, sind alle Schweißperlen auf der Stirn des etwas molligen Mittvierzigers verschwunden. "Kommen Sie mit!" sagt Henckelmann, weiterhin ohne eine Spur von Lockerheit.
Woran er arbeitet, hatte Henckelmann nur am Telefon beschrieben; es klang jedenfalls sehr nach einer Verschwörungstheorie. Er arbeitet in der Abteilung "Kundengesundheit" einer großen deutschen Krankenkasse. Bei dem neuen Programm, das vor allem in diesem Stahlbetonbau in Düsseldorfs Innenstadt entwickelt wird, soll es den Rauchern an den Kragen gehen. "Ans Portemonnaie wollen die uns!" erklärt er und grüßt den Reporter mit einer Zigarette im Mundwinkel. Hier unten treffen sich die verbliebenen Raucher des Gebäudes - laut Henckelmann sind es nicht mehr viele. Als er vor über zwanzig Jahren seine erste Stelle in diesem Gebäude hatte, habe er noch im Büro rauchen dürfen. Seit sein Arbeitgeber jedoch das Programm "ProfitGesund" intern vorbereite, würde Jagd auf die Raucher gemacht. Zuerst innerhalb der Peripherie: "Die Putzen, die Pförtner, das Kantinenpersonal - alle Raucher entlassen!"
Henckelmann lacht nach jeder seiner Äußerungen schnell, geradezu hysterisch. Seine Zigarette hat er verkrampft innerhalb von zwei Minuten zur Kippe minimiert. Er tut sich schwer damit, etwas über das Programm seiner Krankenkasse zu erzählen. Es gehe um Beitragssteigerungen auf ein Vielfaches ihrer jetzigen Höhe, um Zwangsausschlüsse für Raucher und ähnliches. "Die wollen sogar, daß Raucher dazu angehalten werden, bestimmte Buttons am Revers zu tragen, hahha." Er stockt in seinem Abschlußlachen, weil der Fahrstuhl sich wieder in Bewegung gesetzt hat. Schnell schiebt er unsere Kippen hinter einen losen Ziegel am Boden des Kellerraums, in dem wir stehen. Der Aufzug hält tatsächlich auf dieser Etage. Ein paar Schritte sind zu hören, sie müssen von einer Frau kommen. Henckelmann atmet auf. "Lina!" sagt er, als erkläre das alles.
Lina steht bei uns und genießt zwei Zigaretten gleichzeitig. "Eine ist ´ne leichte!" entschuldigt sie den merkwürdigen Anblick, den sie bietet. Henckelmann steckt sich auch noch eine an; er weiß schon, daß es die letzte für die nächsten fünf Stunden bleiben wird. Die beiden haben gegenüber von ihrer Raucherecke das Werbeplakat einer französischen Zigarettenmarke angebracht. "Mit Genehmigung des Hausmeisters, der ist Gelegenheitsraucher", sagt Lina. "Wo bleiben Jörg und Carsten?" will Henckelmann wissen. Sie sind die beiden anderen Raucher unter den 250 Mitarbeitern des Versicherungsunternehmens, die im Haus arbeiten. Lina weiß auch keine Antwort. Merkwürdigerweise hat sie ihre "Light" bereits aufgeraucht, während die stärkere Zigarette noch voll am Glühen ist.
Sie arbeitet im Controlling, und eigentlich müßte ihr Herz höher schlagen, wenn sie an "ProfitGesund" denkt. "Ich bin letzten Monat ausgetreten. 'Wegen meines Freundes', habe ich angegeben! Ich bin nicht mehr bei der Versicherung, für die ich arbeite." Henckelmann kann darauf nur mit einem hysterischen Lachen reagieren. Ihm ist alles egal, er will seinen Job behalten. Daß er nach der Einführung des neuen Konzepts etwa ein Drittel seines Monatslohns "abdrücken" müsse, um auch als Raucher noch krankenversichert zu bleiben, stört ihn nicht. "Nur die Akten muß ich behüten. Ich weiß aber, wer meinen Buchstaben bearbeitet. Die dürfen halt nichts an die Personalabteilung weitergeben."
Die versprochenen fünfzehn Minuten sind um; Henckelmann schickt Lina vor, damit sie nicht gemeinsam aus dem Keller kämen. "Das würde auffallen..." sagt sie. "Und auffallen wollen wir hier nun wirklich nicht!" vollenden die beiden den Satz mit dem kommenden Slogan zum Start von "ProfitGesund". Vor der hektischen Verabschiedung gibt Henckelmann der hübschen Lina noch einen Nikotinkaugummi, auf daß sie die zweite Hälfte ihres Arbeitstages gut überstehe.
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: Neuer Klangdieb-Walkman, Gayhund, "veredelter" Mac
herr denes, 12:24Uhr

.Klangdieb
Der japanische Unterhaltungsgerätehersteller Kotayama bringt noch im Spätherbst dieses Jahres ein neuartiges Gerät auf den Markt, mit dessen Hilfe man den Klang von Walk- und Discmans, die in der Umgebung des Betreibers laufen, abzweigen kann. Sitzt man beispielsweise in der Straßenbahn einem Musikhörenden gegenüber, so kann man auf den eigenen Headphones dasselbe hören wie der Mitfahrende. Dazu muß lediglich der Abschirmungswinkel des Geräts auf 90 Grad gestellt werden. Wie ein Sprecher der Herstellerfirma bekanntgab, soll das Gerät den Namen "Earcatcher" tragen und zunächst etwa öS 2100,- öS/DM 300,- kosten. Der "Earcatcher" sei sowohl in freien wie in geschlossenen Räumen zu betreiben und für jedes Signal empfänglich, das in einer Umgebung von bis zu 200 Metern ausgestrahlt werde. Allerdings könnten keine Gespräche abgehört werden, da der "Earcatcher" nur die Signale von Kopfhörern abtasten und wiedergeben könne. Zum Sinn des Gerätes sagte Kotayamas Sprecher, daß es das lästige Zusammenstellen eigener Musiktapes erspare und eine völlig neue Grundlage für das Knüpfen menschlicher Kontakte aller Art darstelle. Die Zulassungsbehörden in Österreich und Deutschland erklärten bereits im Vorfeld, daß sie den "Earcatcher" nicht zum Import freigeben würden, da das Gerät in seiner Verwendung gegen verfassungsmäßige Grundsätze verstoße.
.Gayhund
Daß Homosexualität in unserer Gesellschaft immer "normaler" wird und breitere Akzeptanz findet, ist eine erfreuliche und bereits bekannte Entwicklung. Relativ neu ist hingegen die Erkenntnis, daß sich auch unter unseren Haustieren Schwule und Lesben befinden. Der Stuttgarter Veterinärmediziner Johannes Buchner stellte kürzlich in seiner Diplomarbeit die Ergebnisse seiner Studie zu den sexuellen Neigungen von Hunden und Katzen vor. In der Tat finden sich in der Arbeit neben unspektakuläreren Thesen auch Befunde, die darauf hindeuten, daß es gleichgeschlechtliche Liebe unter Angehörigen dieser Rassen gibt. So konnte Buchner im Rahmen von mehreren Langzeitbeobachtungen in freien und geschlossenen Räumen insgesamt sieben Fälle von homosexuellem Paarungsverhalten entdecken. Darunter bildeten die acht beteiligten Rüden (analog vier Fälle) die Mehrheit, während vier Katzen gegenüber nur zwei Katern die gleichgeschlechtliche Liebe bevorzugten. Verglichen mit der Grundgesamtheit der untersuchten Haustierbegattungen bilden die observierten homosexuellen Varianten nur einen verschwindend geringen Prozentsatz. Bereits in den fünfziger Jahren fand ein bulgarischer Wissenschaftler übrigens Anzeichen für tierische Homosexualität - doch Georgi Andonov wurde nach der Publikation seiner Arbeit in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Die Ergebnisse Buchners werden demnächst im Sachbuch "Mein Hund, der Schelm" veröffentlicht, dessen Publikation in Bayern von der CSU-Landesregierung bereits vorab untersagt worden ist.
.Kokscomputer
Ein Werksarbeiter von Apple hat in den Jahren 2001 und 2002 mit Kokain gedealt. Der in der zweitgrößten Mac-Produktionsstätte in Taiwan beschäftigte US-Amerikaner war nach Angaben des Computerherstellers für die Endabnahme der Tastaturen verantwortlich. Diese Position soll der heute 39jährige dazu mißbraucht haben, Kokain in die Vereinigten Staaten und nach Europa zu verschieben. Er hat kleine Päckchen unter den Funktionstasten mehrerer "iMacs" und "Yosemites" deponiert, die von Mittelsmännern in den Zwischenlagern in Newark (USA), Dover (UK) und Veendam (NL) in Empfang genommen wurden. Da die Interpol und das FBI schon über einen längeren Zeitraum vor der Verhaftung des Dealers Stichproben in den Zwischenlagern durchführte, die allerdings zu keinem Erfolg führten, sind nach Schätzung von Apple etwa 2500 Rechner im Umlauf, bei deren Tastaturen sich unter den Tasten F6, F7 und F8 Kokain befindet. Der Computerhersteller bittet nun alle Mac-User, nachzuschauen, ob sie im Besitz eines der betreffenden Rechner sind. Mac-Besitzer, die Kokain finden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0049 800 66 67 68 zu melden. Für die Abgabe des Kokains erhalten ehrliche Finder eine kleine Belohnung. Ein Sprecher von Apple wies darauf hin, daß der Besitz, der Konsum und die Weitergabe von Kokain strafbar seien und mit teilweise drakonischen Strafen verfolgt würden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 11. Februar 2004
Faction: Inländerhass (1999)
herr denes, 20:51Uhr
Der Major gibt Mandy noch eine Zigarette aus dem kalbsledernen Etui, öffnet sein Benzinfeuerzeug und sagt zu ihr in reinstem Sächsisch: "Rooch ärscht mö eene!" Die blonde Raucherin nimmt einen tiefen Zug, verdreht ihr linkes Auge und atmet danach tief auf. "Isch habs jeschafft. Ey, zwee Stünden im Westen, ey, isch habs jeschafft." Endlich wieder im Osten angelangt, der Major ist stolz auf seine Freundin. Die beiden wohnen in Hellersdorf, einer großen Plattenbausiedlung am östlichen Stadtrand von Berlin. Für Sachsen ist die deutsche Hauptstadt zu einem gefährlichen Pflaster geworden, aber nicht nur für sie.
In den Medien spielt das Thema noch keine Rolle, die Polizei belächelt es, weist aber auch hinter vorgehaltener Hand auf "eine gewisse Dunkelziffer" hin. Aber auf den Straßen Berlins hat es sich herumgesprochen - es gibt eine neue Tendenz proletarischer Gewalttätigkeit: die Ostländerfeindlichkeit. In den letzten vier Monaten ereigneten sich im Westen der Stadt über zwanzig gewalttätige Straftaten gegen Bürger aus den neuen Bundesländern oder Menschen, die für solche gehalten wurden.
Eine offizielle Chronik über diese Ereignisse gibt es nicht, aber der Major, wie sie den arbeitslosen Schlosser Detlev Manske hier "in der Platte" nennen, hat sie alle im Kopf. Seine Telefonnummer steht unter einer Annonce, die täglich im größten Boulevardblatt des Berliner Ostens geschaltet ist. In der Anzeige werden Ostdeutsche, die von gewalttätigen Jugendlichen im Westteil der Stadt schikaniert oder angegriffen worden sind, dazu aufgefordert, die entsprechenden Vorfälle an Manske zu melden; im Gegenzug verspricht dieser eine psychologische Nachbetreuung. Mandy ist schon zum zweiten Mal beim Major, diesmal ist ihr "so direkt nichts" passiert, doch sie fühlte sich beim Fahrradfahren durch den Innenstadtbezirk Charlottenburg "irgendwie beobachtet und gejagt". An einer Ampel, erzählt Mandy, hätte ihr ein Autofahrer durch das herunter gekurbelte Seitenfenster gesagt: "Na, wie fühlt man sich als Sachse? He?" Mandy kann sich nicht erklären, woher diese Leute wissen, daß sie aus Mitteldeutschland käme, wie sie es ausdrückt. Manske hat dafür seine eigene Theorie: "Dit iss ja nüscht Ethnölogisches. Die gehen ooch nürr nochm wie de ussschaust. Weeßte von den Wangenknochen her, der Münd, die Öhrn. Da iss doch jeeda Hellblonde mit kurzen Haaren ein Ossi bei den Schweinen!" echauffiert sich der Major. "S´wird ja ooch imma schlümma, na? Merr hoben schön die Knie jeschlockert, wie isch mit meene Fomilie neulüsch üban Ku´damm jeloofen bin. Die Blicke von denen. Das sind doch eh fast nühur von die Ohslänner!"
Tatsächlich nimmt die Gewalt gerade gegen blonde Sachsen in den letzten Monaten immens zu. Manske freut sich, daß die Medien endlich auch auf dieses Thema zu sprechen kommen. "Immer nur, wenn die Türken oder Araber oder wasweißichwer was aufs Maul kriegen, da ist das Geschrei groß. Das kann doch aber nicht sein. Immerhin sind wir doch Deutsche!" empört sich der Major, dessen Sächsisch inzwischen eine Intensität erreicht hat, die sich graphisch nicht mehr realisieren läßt. Mandy klopft ihm auf die Schulter und verläßt die zwei Zimmer große Wohnung Manskes wieder. Sie hat sich scheinbar beruhigt. Gelegenheit für Manske, etwas über die Fälle ostländerfeindlicher Gewalt zu erzählen, von denen er in den letzten Monaten gehört hat: "Der bisher dramatischste Zwischenfall ereignete sich im Spätsommer in Wedding, als zwei Jungs hier aus Hellersdorf von einer Gruppe Westberliner Jugendlicher angegriffen wurden. Die beiden Jungs wurden übelst vermöbelt, der eine von ihnen hat bis heute Sehstörungen." Die Frage, warum sie zusammengeschlagen wurden, kann Manske auch nicht beantworten, er kennt aber das Lager, aus dem die Gewalttäter kamen: "Die Jungs haben erzählt, daß die Täter die blau-roten Jacken anhatten, mit dem Apfelaufnäher, und zu weite Hosen. Das waren mit Sicherheit Mixheads!"
Manske phantasiert nicht. In einigen Teilen der Westbezirke gibt es tatsächlich Jugendliche, die sich "Mixheads" nennen, eine Hälfe des Kopfes kahlgeschoren haben und auf der anderen lange Haare tragen. Sie sind die radikale Spitze einer ostländerfeindlichen Stimmung, die sich schon seit Jahren unter vielen Westdeutschen breitgemacht hat. Mixheads sind für eine heterogene Gesellschaft, für Schwule, Behinderte, Ausländer als gleichberechtigte Gruppen und gegen intolerante Ostdeutsche. Das Schlimme an den Mixheads ist, daß sie sich vor ihren Gewalttaten nicht die Mühe machen, herauszufinden, ob die Opfer wirklich Schläge verdient haben. Noch schlimmer allerdings ist die Tatsache an sich, daß sie brutal vorgehen.
"Mit 14 Stichen mußte Falk Heidrich genähnt werden, nur weil er so ein anatolisches Muttchen im Supermarkt beim Klauen erwischt hat. Dafür haben ihm diese Verbrecher das Auge eingeschlagen. Die Frau hat alles in eine Tüte gesteckt, statt sich wie ein normaler Mensch einen Einkaufswagen zu nehmen. Da sagt ihm die Olle noch, daß sie kein Markstück für den Einkaufswagen hatte, da frag ich Sie, wie soll sie dann den Einkauf bezahlen? So sind sie, unsere lieben ausländischen Mitbürger. Das stelle man sich mal vor: Dafür, daß er solche Zustände aufdeckt, wird er zusammengeschlagen, in welchem Land leben wir eigentlich? Falk hat schon gesagt, den sieht Schöneberg nicht mehr." Schöneberg ist auch ein Westbezirk und zudem eine Hochburg von Mixheads. Sie treffen sich in konspirativen Kneipen, in denen vornehmlich jamaikanische Reggae-Musik oder Straight-Edge-Hardcore läuft. Im Gegensatz zu anderen Extremisten fehlt den Mixheads allerdings eine parteiliche Organisation. Dieses Umstand findet nicht nur Manske positiv, denn so fehlt den Halbglatzen das Geld für größer angelegte Aktionen gegen Ostdeutsche.
Standortwechsel. Vom äußersten Osten Berlins ins Zentrum, in die Akazienstraße in Berlin- Schöneberg. An einer Häuserwand lehnen zwei Mixheads. David und Francis seien ihre Namen, verraten sie. Sie verkaufen ostländerfeindliches Propagandamaterial wie Stadtpläne, in denen die Mauer wieder eingezeichnet ist und T- Shirts, auf denen "Sachsen raus!" steht. Die beiden sind vielleicht zwanzig Jahre alt und lachen permanent. Man sieht ihnen ihre Gefährlichkeit nicht an; sie wirken, als wären sie noch Pennäler. Von der Teilung des Landes dürften sie nicht mehr viel mitbekommen haben. Auf Nachfragen, ob es die Devotionalien auch in einem Ladengeschäft zu kaufen gäbe, erklärt David: "Nicht so direkt! Verstehste, das ist ja nicht ganz unproblematisch. Von wegen Staatsschutz, Racheakte." Wofür sich Leute rächen wollten, will keiner der beiden beantworten, das wisse man eben oder nicht. Und auf die Frage, warum sie so seien, antwortet David: "Wie sind wir denn? Bewegt eure Journalistenärsche zurück in den Scheißosten!"
Diese Reaktion ist nur allzu verständlich, haben die Mixheads doch große Angst davor, ins Visier der Medienbranche zu gelangen. Ihre Chancen seien größer, wenn sie unbemerkt blieben, erklärt Francis zum Abschied und gibt einem Passanten ein blaurotes Flugblatt. "Alle Ausländer nach Westdeutschland!" steht darauf geschrieben und ein Termin bei einem Bundestagsabgeordneten des Bezirks. Ein paar Straßen weiter liegt das Büro dieses Abgeordneten, der weder namentlich noch über seine Parteizugehörigkeit genannt werden will. Er erklärt einen der Hauptpläne der Mixhead-Bewegung: "Die Apfelstrategie - daher auch das Logo der Aktivisten. Wir wollen die Ostdeutschen nur noch unter ihresgleichen leben lassen, damit die Ausländerfeindlichkeit endgültig ad absurdum geführt wird", beschreibt der Politiker die diffusen Ideen einer Gruppe gewaltbereiter Chaoten. Von ihren brutalen Straftaten will der Volksvertreter nichts wissen: "Glauben Sie nicht, was Ihnen die Ostler erzählen. Die wollen doch nur von den Medien hofiert werden. Kann sein, daß da mal ein paar häßliche Worte gefallen sind, aber mehr auch nicht." An die Ereignisse, über die Manske berichtet hat, glaubt der aus Moers/Nordrhein-Westfalen stammende Bundestagsabgeordnete nicht. "Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum der den Spitznamen 'Major' erhalten hat? Nach der Stasi-Auflösung mußte der sich eine neue Betätigung suchen. Immer schön archivieren, das können sie!" Der Mann macht nicht den Eindruck, als würde er sich schützend vor einen Ostdeutschen stellen, wenn dieser in seiner Anwesenheit von Mixheads geschlagen würde. Diese Haltung scheint bezeichnend für die Ignoranz oder gar das Wohlwollen, mit denen viele Vertreter der Gesellschaft diese neue Bewegung betrachten.
In Deutschland gibt es - als hätten wir nicht schon genug davon - also ein neues Problem. Nach mittlerweile zehn Jahren Deutscher Einheit haben sich die Menschen aus den beiden Teilen des Landes nicht angenähert, sich nicht verstehen und geschweige denn lieben gelernt. Natürlich gibt es einige Ausnahmen, aber auf der Straße wird immer mehr eine andere Sprache gesprochen, die primitivste, die Menschen überhaupt als Ausdrucksmittel haben: pure Gewalt. Der Westen hat sich an den rechtsextremen Schlägern in der ostdeutschen Provinz ein schlechtes Beispiel genommen und hat nun in Form der Mixheads seine eigene Jugendkrise. Quo vadis, Germania?
In den Medien spielt das Thema noch keine Rolle, die Polizei belächelt es, weist aber auch hinter vorgehaltener Hand auf "eine gewisse Dunkelziffer" hin. Aber auf den Straßen Berlins hat es sich herumgesprochen - es gibt eine neue Tendenz proletarischer Gewalttätigkeit: die Ostländerfeindlichkeit. In den letzten vier Monaten ereigneten sich im Westen der Stadt über zwanzig gewalttätige Straftaten gegen Bürger aus den neuen Bundesländern oder Menschen, die für solche gehalten wurden.
Eine offizielle Chronik über diese Ereignisse gibt es nicht, aber der Major, wie sie den arbeitslosen Schlosser Detlev Manske hier "in der Platte" nennen, hat sie alle im Kopf. Seine Telefonnummer steht unter einer Annonce, die täglich im größten Boulevardblatt des Berliner Ostens geschaltet ist. In der Anzeige werden Ostdeutsche, die von gewalttätigen Jugendlichen im Westteil der Stadt schikaniert oder angegriffen worden sind, dazu aufgefordert, die entsprechenden Vorfälle an Manske zu melden; im Gegenzug verspricht dieser eine psychologische Nachbetreuung. Mandy ist schon zum zweiten Mal beim Major, diesmal ist ihr "so direkt nichts" passiert, doch sie fühlte sich beim Fahrradfahren durch den Innenstadtbezirk Charlottenburg "irgendwie beobachtet und gejagt". An einer Ampel, erzählt Mandy, hätte ihr ein Autofahrer durch das herunter gekurbelte Seitenfenster gesagt: "Na, wie fühlt man sich als Sachse? He?" Mandy kann sich nicht erklären, woher diese Leute wissen, daß sie aus Mitteldeutschland käme, wie sie es ausdrückt. Manske hat dafür seine eigene Theorie: "Dit iss ja nüscht Ethnölogisches. Die gehen ooch nürr nochm wie de ussschaust. Weeßte von den Wangenknochen her, der Münd, die Öhrn. Da iss doch jeeda Hellblonde mit kurzen Haaren ein Ossi bei den Schweinen!" echauffiert sich der Major. "S´wird ja ooch imma schlümma, na? Merr hoben schön die Knie jeschlockert, wie isch mit meene Fomilie neulüsch üban Ku´damm jeloofen bin. Die Blicke von denen. Das sind doch eh fast nühur von die Ohslänner!"
Tatsächlich nimmt die Gewalt gerade gegen blonde Sachsen in den letzten Monaten immens zu. Manske freut sich, daß die Medien endlich auch auf dieses Thema zu sprechen kommen. "Immer nur, wenn die Türken oder Araber oder wasweißichwer was aufs Maul kriegen, da ist das Geschrei groß. Das kann doch aber nicht sein. Immerhin sind wir doch Deutsche!" empört sich der Major, dessen Sächsisch inzwischen eine Intensität erreicht hat, die sich graphisch nicht mehr realisieren läßt. Mandy klopft ihm auf die Schulter und verläßt die zwei Zimmer große Wohnung Manskes wieder. Sie hat sich scheinbar beruhigt. Gelegenheit für Manske, etwas über die Fälle ostländerfeindlicher Gewalt zu erzählen, von denen er in den letzten Monaten gehört hat: "Der bisher dramatischste Zwischenfall ereignete sich im Spätsommer in Wedding, als zwei Jungs hier aus Hellersdorf von einer Gruppe Westberliner Jugendlicher angegriffen wurden. Die beiden Jungs wurden übelst vermöbelt, der eine von ihnen hat bis heute Sehstörungen." Die Frage, warum sie zusammengeschlagen wurden, kann Manske auch nicht beantworten, er kennt aber das Lager, aus dem die Gewalttäter kamen: "Die Jungs haben erzählt, daß die Täter die blau-roten Jacken anhatten, mit dem Apfelaufnäher, und zu weite Hosen. Das waren mit Sicherheit Mixheads!"
Manske phantasiert nicht. In einigen Teilen der Westbezirke gibt es tatsächlich Jugendliche, die sich "Mixheads" nennen, eine Hälfe des Kopfes kahlgeschoren haben und auf der anderen lange Haare tragen. Sie sind die radikale Spitze einer ostländerfeindlichen Stimmung, die sich schon seit Jahren unter vielen Westdeutschen breitgemacht hat. Mixheads sind für eine heterogene Gesellschaft, für Schwule, Behinderte, Ausländer als gleichberechtigte Gruppen und gegen intolerante Ostdeutsche. Das Schlimme an den Mixheads ist, daß sie sich vor ihren Gewalttaten nicht die Mühe machen, herauszufinden, ob die Opfer wirklich Schläge verdient haben. Noch schlimmer allerdings ist die Tatsache an sich, daß sie brutal vorgehen.
"Mit 14 Stichen mußte Falk Heidrich genähnt werden, nur weil er so ein anatolisches Muttchen im Supermarkt beim Klauen erwischt hat. Dafür haben ihm diese Verbrecher das Auge eingeschlagen. Die Frau hat alles in eine Tüte gesteckt, statt sich wie ein normaler Mensch einen Einkaufswagen zu nehmen. Da sagt ihm die Olle noch, daß sie kein Markstück für den Einkaufswagen hatte, da frag ich Sie, wie soll sie dann den Einkauf bezahlen? So sind sie, unsere lieben ausländischen Mitbürger. Das stelle man sich mal vor: Dafür, daß er solche Zustände aufdeckt, wird er zusammengeschlagen, in welchem Land leben wir eigentlich? Falk hat schon gesagt, den sieht Schöneberg nicht mehr." Schöneberg ist auch ein Westbezirk und zudem eine Hochburg von Mixheads. Sie treffen sich in konspirativen Kneipen, in denen vornehmlich jamaikanische Reggae-Musik oder Straight-Edge-Hardcore läuft. Im Gegensatz zu anderen Extremisten fehlt den Mixheads allerdings eine parteiliche Organisation. Dieses Umstand findet nicht nur Manske positiv, denn so fehlt den Halbglatzen das Geld für größer angelegte Aktionen gegen Ostdeutsche.
Standortwechsel. Vom äußersten Osten Berlins ins Zentrum, in die Akazienstraße in Berlin- Schöneberg. An einer Häuserwand lehnen zwei Mixheads. David und Francis seien ihre Namen, verraten sie. Sie verkaufen ostländerfeindliches Propagandamaterial wie Stadtpläne, in denen die Mauer wieder eingezeichnet ist und T- Shirts, auf denen "Sachsen raus!" steht. Die beiden sind vielleicht zwanzig Jahre alt und lachen permanent. Man sieht ihnen ihre Gefährlichkeit nicht an; sie wirken, als wären sie noch Pennäler. Von der Teilung des Landes dürften sie nicht mehr viel mitbekommen haben. Auf Nachfragen, ob es die Devotionalien auch in einem Ladengeschäft zu kaufen gäbe, erklärt David: "Nicht so direkt! Verstehste, das ist ja nicht ganz unproblematisch. Von wegen Staatsschutz, Racheakte." Wofür sich Leute rächen wollten, will keiner der beiden beantworten, das wisse man eben oder nicht. Und auf die Frage, warum sie so seien, antwortet David: "Wie sind wir denn? Bewegt eure Journalistenärsche zurück in den Scheißosten!"
Diese Reaktion ist nur allzu verständlich, haben die Mixheads doch große Angst davor, ins Visier der Medienbranche zu gelangen. Ihre Chancen seien größer, wenn sie unbemerkt blieben, erklärt Francis zum Abschied und gibt einem Passanten ein blaurotes Flugblatt. "Alle Ausländer nach Westdeutschland!" steht darauf geschrieben und ein Termin bei einem Bundestagsabgeordneten des Bezirks. Ein paar Straßen weiter liegt das Büro dieses Abgeordneten, der weder namentlich noch über seine Parteizugehörigkeit genannt werden will. Er erklärt einen der Hauptpläne der Mixhead-Bewegung: "Die Apfelstrategie - daher auch das Logo der Aktivisten. Wir wollen die Ostdeutschen nur noch unter ihresgleichen leben lassen, damit die Ausländerfeindlichkeit endgültig ad absurdum geführt wird", beschreibt der Politiker die diffusen Ideen einer Gruppe gewaltbereiter Chaoten. Von ihren brutalen Straftaten will der Volksvertreter nichts wissen: "Glauben Sie nicht, was Ihnen die Ostler erzählen. Die wollen doch nur von den Medien hofiert werden. Kann sein, daß da mal ein paar häßliche Worte gefallen sind, aber mehr auch nicht." An die Ereignisse, über die Manske berichtet hat, glaubt der aus Moers/Nordrhein-Westfalen stammende Bundestagsabgeordnete nicht. "Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum der den Spitznamen 'Major' erhalten hat? Nach der Stasi-Auflösung mußte der sich eine neue Betätigung suchen. Immer schön archivieren, das können sie!" Der Mann macht nicht den Eindruck, als würde er sich schützend vor einen Ostdeutschen stellen, wenn dieser in seiner Anwesenheit von Mixheads geschlagen würde. Diese Haltung scheint bezeichnend für die Ignoranz oder gar das Wohlwollen, mit denen viele Vertreter der Gesellschaft diese neue Bewegung betrachten.
In Deutschland gibt es - als hätten wir nicht schon genug davon - also ein neues Problem. Nach mittlerweile zehn Jahren Deutscher Einheit haben sich die Menschen aus den beiden Teilen des Landes nicht angenähert, sich nicht verstehen und geschweige denn lieben gelernt. Natürlich gibt es einige Ausnahmen, aber auf der Straße wird immer mehr eine andere Sprache gesprochen, die primitivste, die Menschen überhaupt als Ausdrucksmittel haben: pure Gewalt. Der Westen hat sich an den rechtsextremen Schlägern in der ostdeutschen Provinz ein schlechtes Beispiel genommen und hat nun in Form der Mixheads seine eigene Jugendkrise. Quo vadis, Germania?
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: Geschäftsideen. Geschmack verkehrt.
herr denes, 20:49Uhr
Da die letzten Interviews dieser Rubrik stets in gastronomischen Einrichtungen geführt wurden, hielt ich es für angebracht, in dieser Folge ein höchst seltsames Lokal vorzustellen - auch wenn dies ein wenig aus der Reihe ungewöhnlicher Berufsporträts herausfällt. Legitim ist es trotzdem, weil hinter dem Aachener Restaurant, das Sie im Folgenden ein wenig näher kennenlernen werden, die Idee eines Mannes steht, der schon seit Jahren ein Faible für unkonventionelle Existenzgründungen zu haben scheint.
Ramon Schulte erwartet mich an diesem Tag in seinem Lokal "Invers" und trägt eines dieser neumodischen "Innen-nach-außen"-Hemden, bei denen die Nähte auf der Oberfläche des Stoffes liegen. Er ist ein großer, hagerer Mann mit einer auffälligen, blaugerahmten Brille, und hat einen starren Blick, ungefähr so wie Christoph Daum oder Vera
Russwurm. Na ja, die Russwurm ist in diesem Zusammenhang vielleicht doch etwas unpassend, weil sein Blick nicht ganz so glubschäugig ist - aber Schultes Augen drücken ungefähr soviel Wärme aus wie die der Showmasterin. Nachdem ich das "Invers" betreten habe, bittet er mich, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, bei dem die Lehne nicht den Rücken, sondern den Bauch stützt.
FAKTENFIKTION: Hier ist einiges anders als in den Restaurants, die ich bisher aufgesucht habe.
Schulte: Si Senor! Das liegen Sie mal verdammt richtig.
FAKTENFIKTION: Ihr Lokal heißt "Invers" - vielleicht, weil hier alles umgekehrt ist?
Schulte: Yo! Wie Ihr Stuhl!
FAKTENFIKTION: Lassen Sie mich das einmal kurz durchspielen. Man kommt also hierher, um zu essenÖ
Schulte: Ja, aber zuerst einmal muß man zahlen.
FAKTENFIKTION: Ist das nicht sehr unhöflich? Kassieren, bevor man etwas geleistet hat?
Schulte: Nope! Das ist das Konzept. Außerdem fühlen sich die Gäste wohl, wenn sie wissen, wieviel sie der Genuß kostet. Und die Ober wissen gleich, wie gut das Trinkgeld war.
FAKTENFIKTION: Ach, Trinkgeld muß man auch geben?
Schulte: Muß, muß? Man muß nicht, aber es gehört sich doch.
FAKTENFIKTION: Und woher weiß der Gast, wie hoch seine Rechnung sein wird?
Schulte: Meistens geben die Gäste bestimmte Pauschalbeträge. Zum Beispiel 80 Mark (knapp öS 600,-; Anm. d Red.) für zwei Personen. Davor noch etwas Trinkgeld. Und dann schauen die Leute, wie weit sie damit kommen.
FAKTENFIKTION: Verstehe. Und wenn die Gäste nun sehr knausrig sind?
Schulte: Dann kriegen sie einen Gang weniger oder kleinere Portionen!
FAKTENFIKTION: Was passiert denn dann nach dem Bezahlen?
Schulte: Aber, Senor - denken Sie doch einfach mit!
FAKTENFIKTION: Zuerst kommt wahrscheinlich das Dessert auf den Tisch.
Schulte: Gar nicht schlecht. Es ist aber noch ein wenig mehr. Die Gäste werden von den Kellnern gefragt, ob es geschmeckt haben wird. Und da können unsere Kunden durch bestimmte Sätze beeinflussen, was sie bekommen. Dann lassen die Ober ihnen Zeit, um eine Zigarette zu rauchen.
FAKTENFIKTION: Das ist ja perfekt umgedreht. Erzählen Sie weiter!
Schulte: Tja, Gäste, die ein gutes Trinkgeld gegeben haben, kriegen dann erst einmal einen Digestiv oder einen Espresso "aufs Haus". Und dann kommt, wie Sie eben schon sagten, die Nachspeise.
FAKTENFIKTION: Da fängt dann so ein Mahl bei Ihnen mit Sorbet oder Mousse an?
Schulte: So ist es. Und natürlich mit den Getränken. Die sind ja genau wie bei einem normalen Restaurant.
FAKTENFIKTION: Bis auf die Gläser anscheinend, wie ich hier sehe.
Schulte (lacht): Naja, das mit dem Bierglas für den Wein ist ein neuer Versuch. Ich finde das zwar ein wenig affig, aber komischerweise sind die Gäste davon begeistert.
FAKTENFIKTION: Bleiben wir noch kurz beim Ablauf. Nach dem Nachtisch kommt was...?
Schulte: Die Hauptspeise natürlich. Erst die zusätzlichen Beilagen und dann das eigentliche Hauptgericht. Dann folgt meist der Salat und, wenn die Gäste vorher genug bezahlt haben, noch eine Suppe oder ein Nudelgericht.
FAKTENFIKTION: Pfui! Ihren Kunden muß sich da doch der Magen umdrehen. Kommt da irgend jemand wieder?
Schulte: Wir sind jeden Abend ausgebucht. Täglich ist die Hütte voll, sogar unter der Woche. Und das "Invers" hat viele Stammkunden.
FAKTENFIKTION: Wissen Sie, ich frage auch deswegen, weil ich schon länger vorhatte, Sie einmal näher vorzustellen. Das "Invers" ist ja nicht Ihr erster merkwürdiger Neuanfang, Herr Schulte.
Schulte: Ich weiß, worauf Sie anspielen. Aber das hat nichts mit meinem Lokal zu tun!
FAKTENFIKTION: Erzählen Sie doch mal von Ihrem Friseursalon!
Schulte: Das war eine tolle Sache für die Gäste. Das "Studio Diametral". Die Kunden kamen unzufrieden vom Friseur, und wir haben etwas aus ihnen gemacht.
FAKTENFIKTION: Vor allen Dingen Geld!
Schulte: Das ist jetzt aber doch sehr polemisch. Ich habe spießigen Leuten zu einer tollen Frisur verholfen. Daß ich dafür Geld genommen habe, ist doch nicht verwerflich. Ich bin schließlich nicht die Caritas.
FAKTENFIKTION: Sie haben den Leuten zu einer Tolle verholfen, muß es eher heißen. Damals zerzausten Sie den Kunden doch ohne Sinn, Verstand und Ausbildung die Haare.
Schulte: Was soll´s? Man hat das "Studio Diametral" ja ohnehin geschlossen.
FAKTENFIKTION: Ich kann mich aber noch an ein Kreditinstitut namens "Antipoden" erinnern, mit dem Sie Ihre umgedrehten Geschäftspraktiken auch schon ausprobierten.
Schulte: Ich möchte das Gespräch jetzt lieber beenden.
FAKTENFIKTION: Tja, dann danke ich Ihnen und wünsche noch viel Erfolg mit diesem Restaurant.
Struck: Danke und herzlich willkommen im "Invers"!
Ramon Schulte erwartet mich an diesem Tag in seinem Lokal "Invers" und trägt eines dieser neumodischen "Innen-nach-außen"-Hemden, bei denen die Nähte auf der Oberfläche des Stoffes liegen. Er ist ein großer, hagerer Mann mit einer auffälligen, blaugerahmten Brille, und hat einen starren Blick, ungefähr so wie Christoph Daum oder Vera
Russwurm. Na ja, die Russwurm ist in diesem Zusammenhang vielleicht doch etwas unpassend, weil sein Blick nicht ganz so glubschäugig ist - aber Schultes Augen drücken ungefähr soviel Wärme aus wie die der Showmasterin. Nachdem ich das "Invers" betreten habe, bittet er mich, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, bei dem die Lehne nicht den Rücken, sondern den Bauch stützt.
FAKTENFIKTION: Hier ist einiges anders als in den Restaurants, die ich bisher aufgesucht habe.
Schulte: Si Senor! Das liegen Sie mal verdammt richtig.
FAKTENFIKTION: Ihr Lokal heißt "Invers" - vielleicht, weil hier alles umgekehrt ist?
Schulte: Yo! Wie Ihr Stuhl!
FAKTENFIKTION: Lassen Sie mich das einmal kurz durchspielen. Man kommt also hierher, um zu essenÖ
Schulte: Ja, aber zuerst einmal muß man zahlen.
FAKTENFIKTION: Ist das nicht sehr unhöflich? Kassieren, bevor man etwas geleistet hat?
Schulte: Nope! Das ist das Konzept. Außerdem fühlen sich die Gäste wohl, wenn sie wissen, wieviel sie der Genuß kostet. Und die Ober wissen gleich, wie gut das Trinkgeld war.
FAKTENFIKTION: Ach, Trinkgeld muß man auch geben?
Schulte: Muß, muß? Man muß nicht, aber es gehört sich doch.
FAKTENFIKTION: Und woher weiß der Gast, wie hoch seine Rechnung sein wird?
Schulte: Meistens geben die Gäste bestimmte Pauschalbeträge. Zum Beispiel 80 Mark (knapp öS 600,-; Anm. d Red.) für zwei Personen. Davor noch etwas Trinkgeld. Und dann schauen die Leute, wie weit sie damit kommen.
FAKTENFIKTION: Verstehe. Und wenn die Gäste nun sehr knausrig sind?
Schulte: Dann kriegen sie einen Gang weniger oder kleinere Portionen!
FAKTENFIKTION: Was passiert denn dann nach dem Bezahlen?
Schulte: Aber, Senor - denken Sie doch einfach mit!
FAKTENFIKTION: Zuerst kommt wahrscheinlich das Dessert auf den Tisch.
Schulte: Gar nicht schlecht. Es ist aber noch ein wenig mehr. Die Gäste werden von den Kellnern gefragt, ob es geschmeckt haben wird. Und da können unsere Kunden durch bestimmte Sätze beeinflussen, was sie bekommen. Dann lassen die Ober ihnen Zeit, um eine Zigarette zu rauchen.
FAKTENFIKTION: Das ist ja perfekt umgedreht. Erzählen Sie weiter!
Schulte: Tja, Gäste, die ein gutes Trinkgeld gegeben haben, kriegen dann erst einmal einen Digestiv oder einen Espresso "aufs Haus". Und dann kommt, wie Sie eben schon sagten, die Nachspeise.
FAKTENFIKTION: Da fängt dann so ein Mahl bei Ihnen mit Sorbet oder Mousse an?
Schulte: So ist es. Und natürlich mit den Getränken. Die sind ja genau wie bei einem normalen Restaurant.
FAKTENFIKTION: Bis auf die Gläser anscheinend, wie ich hier sehe.
Schulte (lacht): Naja, das mit dem Bierglas für den Wein ist ein neuer Versuch. Ich finde das zwar ein wenig affig, aber komischerweise sind die Gäste davon begeistert.
FAKTENFIKTION: Bleiben wir noch kurz beim Ablauf. Nach dem Nachtisch kommt was...?
Schulte: Die Hauptspeise natürlich. Erst die zusätzlichen Beilagen und dann das eigentliche Hauptgericht. Dann folgt meist der Salat und, wenn die Gäste vorher genug bezahlt haben, noch eine Suppe oder ein Nudelgericht.
FAKTENFIKTION: Pfui! Ihren Kunden muß sich da doch der Magen umdrehen. Kommt da irgend jemand wieder?
Schulte: Wir sind jeden Abend ausgebucht. Täglich ist die Hütte voll, sogar unter der Woche. Und das "Invers" hat viele Stammkunden.
FAKTENFIKTION: Wissen Sie, ich frage auch deswegen, weil ich schon länger vorhatte, Sie einmal näher vorzustellen. Das "Invers" ist ja nicht Ihr erster merkwürdiger Neuanfang, Herr Schulte.
Schulte: Ich weiß, worauf Sie anspielen. Aber das hat nichts mit meinem Lokal zu tun!
FAKTENFIKTION: Erzählen Sie doch mal von Ihrem Friseursalon!
Schulte: Das war eine tolle Sache für die Gäste. Das "Studio Diametral". Die Kunden kamen unzufrieden vom Friseur, und wir haben etwas aus ihnen gemacht.
FAKTENFIKTION: Vor allen Dingen Geld!
Schulte: Das ist jetzt aber doch sehr polemisch. Ich habe spießigen Leuten zu einer tollen Frisur verholfen. Daß ich dafür Geld genommen habe, ist doch nicht verwerflich. Ich bin schließlich nicht die Caritas.
FAKTENFIKTION: Sie haben den Leuten zu einer Tolle verholfen, muß es eher heißen. Damals zerzausten Sie den Kunden doch ohne Sinn, Verstand und Ausbildung die Haare.
Schulte: Was soll´s? Man hat das "Studio Diametral" ja ohnehin geschlossen.
FAKTENFIKTION: Ich kann mich aber noch an ein Kreditinstitut namens "Antipoden" erinnern, mit dem Sie Ihre umgedrehten Geschäftspraktiken auch schon ausprobierten.
Schulte: Ich möchte das Gespräch jetzt lieber beenden.
FAKTENFIKTION: Tja, dann danke ich Ihnen und wünsche noch viel Erfolg mit diesem Restaurant.
Struck: Danke und herzlich willkommen im "Invers"!
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: Fahrkarten für's Liebesglück.
herr denes, 20:46Uhr
Warum denkt man bei Schwaben bloß immer nur an Spätzle, Spießer und Spielverderber? Da muß es doch mehr geben...
FAKTENFIKTION: Wie lange fährt man von Biberach nach Ulm, Jockle?
Jockle: 25 Minuten.
FAKTENFIKTION: Und das reicht?
Jockle: Manchmal ja, manchmal nein. Wenn ich auf Partnersuche bin, wie man so sagt, nehm´ ich auch gern die Strecke nach Lindau. Da am Bodensee sind eh die besseren Mädels.
FAKTENFIKTION: Wieviel Zeit haben Sie auf der Lindau-Verbindung?
Jockle: Genug - aber das kommt natürlich teurer. Dafür hab´ ich 75 Minuten, also eine und dann noch eine Viertelstunde. Da ist die Chance größer. Und ich habe ohnehin eine Jahresnetzkarte für den Abschnitt von Ulm nach Lindau. Da liegt ja Biberach mittendrin.
FAKTENFIKTION: Das mit der Zeit dürfte jetzt klar sein. Aber wie läuft denn das Kennenlernen ab?
Jockle: Ich fahre also mit dem Regionalzug los und habe mein Monatsticket in der Tasche und dann immer noch einen anderen Fahrschein. Das ist nämlich so bei uns: Da direkt drin im Zug selbst kannst du nix mehr lösen. Kommt dann eine Kontrolle und du hast kein Ticket, mußt was zahlen.
FAKTENFIKTION: Erhöhtes Beförderungsentgeld?
Jockle: Freile!
FAKTENFIKTION: Wie hoch ist das?
Jockle: Das sind 40 Euro, plus der Preis für des reguläre Ticket.
FAKTENFIKTION: Und was hat das mit der Partnersuche zu tun?
Jockle: Ja, also ich setze mich immer gegen Fahrtrichtung auf so einen Doppelsitzer, ganz am Ende vom Großraumwagen. Da hat man zwei Waggons im Blick. Wenn dann der Schaffner kommt, läuft der immer in Fahrtrichtung. Ich sehe dann also, wen er kontrolliert und wer ein Ticket hat.
FAKTENFIKTION: Interessant. Und weiter?
Jockle: Manchmal sehe ich dann Leute ohne Ticket, und dann springe ich auf. Ich gehe zum Schaffner und sage ihm, daß das meine Freundin ist und wir hätten uns gestritten. Ich zeige ihm dann meine Monatskarte und den zusätzlichen Fahrschein.
FAKTENFIKTION: Das war zu erwarten. Wie reagieren die Schwarzfahrerinnen?
Jockle: Das ist mein Problem. Mal so, mal so. Was ein gescheites Mädel ist, die stimmt mir zu und tut dann vor dem Schaffner so, als hätten wir uns echt gestritten. Die sagt dann: "Ja, genau. Gib mir meinen Fahrschein und zieh ab!"
FAKTENFIKTION: Das ist nicht gescheit, sondern unverschämt!
Jockle: Sehen Sie, das denke ich auch. Aber ich bin ein einfacher Mann. Wenn das Mädel denkt: "So ein Typ, der will m i c h anbaggern?", dann kann ich der das ja auch nicht übelnehmen, net?
FAKTENFIKTION: Wie hoch ist denn die "Durchfallquote"?
Jockle: 97 Prozent - ich hab´ das mit Hilfe eines Freundes mal ausgerechnet.
FAKTENFIKTION: Heißt das, daß es schon dreimal geklappt hat?
Jockle: Nicht direkt.
FAKTENFIKTION: Sondern?
Jockle: Nun ja. Freile hätte es dreimal geklappt, aber bei uns, hier in der Region, da fahren nicht so viele Frauen schwarz.
FAKTENFIKTION: Nun mal Butter bei die Fische! Wie viele Frauen haben Sie auf diese Weise kennengelernt?
Jockle: Jo, kennengelernt habe ich doch einige. Bestimmt an die zwanzig.
FAKTENFIKTION: Und wie viele ... na ja, Sie wissen schon?
Jockle: Das kann man im Nachhinein ganz schwer sagen. Letztendlich liegt es ja an mir. Ich mein´, über die Geschichte mit dem zweiten Fahrschein kommt man ins Gespräch. Dann trifft man sich vielleicht mal zwanglos auf ein Gläschen Erdbeerbowle. Und...
FAKTENFIKTION: Wie viele?
Jockle: Zwei. Eigentlich nur eine.
FAKTENFIKTION: Überlegen Sie sich vielleicht schon eine neue Masche?
Jockle: Nein, überhaupt nicht. Ich denke stark über einen Umzug in ein Ballungszentrum nach. Da sind mehr Schwarzfahrer. Dort, das ist dort auch ein ganz anderes Klima. Da wird auch die Inspiration geschätzt.
FAKTENFIKTION: Sie sind momentan Single?
Jockle: Freile!
FAKTENFIKTION: Wie lange fährt man von Biberach nach Ulm, Jockle?
Jockle: 25 Minuten.
FAKTENFIKTION: Und das reicht?
Jockle: Manchmal ja, manchmal nein. Wenn ich auf Partnersuche bin, wie man so sagt, nehm´ ich auch gern die Strecke nach Lindau. Da am Bodensee sind eh die besseren Mädels.
FAKTENFIKTION: Wieviel Zeit haben Sie auf der Lindau-Verbindung?
Jockle: Genug - aber das kommt natürlich teurer. Dafür hab´ ich 75 Minuten, also eine und dann noch eine Viertelstunde. Da ist die Chance größer. Und ich habe ohnehin eine Jahresnetzkarte für den Abschnitt von Ulm nach Lindau. Da liegt ja Biberach mittendrin.
FAKTENFIKTION: Das mit der Zeit dürfte jetzt klar sein. Aber wie läuft denn das Kennenlernen ab?
Jockle: Ich fahre also mit dem Regionalzug los und habe mein Monatsticket in der Tasche und dann immer noch einen anderen Fahrschein. Das ist nämlich so bei uns: Da direkt drin im Zug selbst kannst du nix mehr lösen. Kommt dann eine Kontrolle und du hast kein Ticket, mußt was zahlen.
FAKTENFIKTION: Erhöhtes Beförderungsentgeld?
Jockle: Freile!
FAKTENFIKTION: Wie hoch ist das?
Jockle: Das sind 40 Euro, plus der Preis für des reguläre Ticket.
FAKTENFIKTION: Und was hat das mit der Partnersuche zu tun?
Jockle: Ja, also ich setze mich immer gegen Fahrtrichtung auf so einen Doppelsitzer, ganz am Ende vom Großraumwagen. Da hat man zwei Waggons im Blick. Wenn dann der Schaffner kommt, läuft der immer in Fahrtrichtung. Ich sehe dann also, wen er kontrolliert und wer ein Ticket hat.
FAKTENFIKTION: Interessant. Und weiter?
Jockle: Manchmal sehe ich dann Leute ohne Ticket, und dann springe ich auf. Ich gehe zum Schaffner und sage ihm, daß das meine Freundin ist und wir hätten uns gestritten. Ich zeige ihm dann meine Monatskarte und den zusätzlichen Fahrschein.
FAKTENFIKTION: Das war zu erwarten. Wie reagieren die Schwarzfahrerinnen?
Jockle: Das ist mein Problem. Mal so, mal so. Was ein gescheites Mädel ist, die stimmt mir zu und tut dann vor dem Schaffner so, als hätten wir uns echt gestritten. Die sagt dann: "Ja, genau. Gib mir meinen Fahrschein und zieh ab!"
FAKTENFIKTION: Das ist nicht gescheit, sondern unverschämt!
Jockle: Sehen Sie, das denke ich auch. Aber ich bin ein einfacher Mann. Wenn das Mädel denkt: "So ein Typ, der will m i c h anbaggern?", dann kann ich der das ja auch nicht übelnehmen, net?
FAKTENFIKTION: Wie hoch ist denn die "Durchfallquote"?
Jockle: 97 Prozent - ich hab´ das mit Hilfe eines Freundes mal ausgerechnet.
FAKTENFIKTION: Heißt das, daß es schon dreimal geklappt hat?
Jockle: Nicht direkt.
FAKTENFIKTION: Sondern?
Jockle: Nun ja. Freile hätte es dreimal geklappt, aber bei uns, hier in der Region, da fahren nicht so viele Frauen schwarz.
FAKTENFIKTION: Nun mal Butter bei die Fische! Wie viele Frauen haben Sie auf diese Weise kennengelernt?
Jockle: Jo, kennengelernt habe ich doch einige. Bestimmt an die zwanzig.
FAKTENFIKTION: Und wie viele ... na ja, Sie wissen schon?
Jockle: Das kann man im Nachhinein ganz schwer sagen. Letztendlich liegt es ja an mir. Ich mein´, über die Geschichte mit dem zweiten Fahrschein kommt man ins Gespräch. Dann trifft man sich vielleicht mal zwanglos auf ein Gläschen Erdbeerbowle. Und...
FAKTENFIKTION: Wie viele?
Jockle: Zwei. Eigentlich nur eine.
FAKTENFIKTION: Überlegen Sie sich vielleicht schon eine neue Masche?
Jockle: Nein, überhaupt nicht. Ich denke stark über einen Umzug in ein Ballungszentrum nach. Da sind mehr Schwarzfahrer. Dort, das ist dort auch ein ganz anderes Klima. Da wird auch die Inspiration geschätzt.
FAKTENFIKTION: Sie sind momentan Single?
Jockle: Freile!
... link (0 Kommentare) ... comment
Faction: La selezione... [Rap-Kochbuch, Trendvorhersage,
herr denes, 20:41Uhr
Ab heute auf FaktenFiktion - The best of Faction. "Faction" ist der Name einer Rubrik mit fiktionalen Beiträgen, die ich einige Jahre lang im EVOLVER veröffentlicht habe.
Hier kommen einige fiktionale Nachrichten zum Auftakt:
.Gourmet-Gangsta
Rap und HipHop erfreuen sich bei den Teenies nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Dieser Umstand schlägt sich auch in wiederkehrenden hohen Charts-Plazierungen der einschlägigen Acts nieder. Einer dieser Pop-Promis ist LL Cool J, ganz nebenbei einer der Pioniere des Gangsta-Rap. Der hat kürzlich bei einem Vortrag an der Academy for Popular Music Research (APMR) in Boston über den Mangel an frischen, neuen Ideen in der auch von ihm gefüllten Musiksparte referiert: "Etwas wirklich Neues gab es seit fünf Jahren nicht mehr." Der Altmeister kritisierte nicht nur, sondern stellte auch gleich sein neues Projekt vor, das ohne Frage frischen Wind in die Szene der bösen Buben wehen wird. LL Cool J bringt im August dieses Jahres sein neues Album heraus, auf dem sich 14 gerappte Kochrezepte befinden werden. Die Tracklist mutet lecker an, finden sich doch Songtitel wie "Ghetto-Turkey à la Hollandaise" oder "I´ve Got Her Witta Halibut" wieder. Den Vogel schießt allerdings die erste Single ab - sie heißt "One Fork in My Knuckle of Pork". Guten Appetit.
.Rasieren ist passé
Frauen haben die Last des Kinderkriegens zu tragen, Männer müssen sich dagegen mindestens dreimal in der Woche rasieren. Am "Problem" der Schwangerschaft arbeitet die Gentechnik, doch die Sache mit dem Rasieren scheint bereits gelöst. Noch in diesem Jahr kommt eine neue Creme auf den Markt, die "Rasura" heißen und dem Mann das lästige Kürzen seines Bartwuchses ersparen soll. Das Wundermittel braucht nur jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, auf die Stoppeln aufgetragen und nach einer halben Stunde mit warmem Wasser abgewaschen zu werden. Der amerikanische Hersteller weist in der Produktbeschreibung darauf hin, daß es sich nicht um eine gewöhnliche Enthaarungscreme handle, sondern um eine Art chemische Rasur, bei der die Stoppeln zersetzt würden, ohne daß die feine Haut des männlichen Gesichtes dabei Schaden erleide.
. Absehbare Trends
Es gibt Soziologen, die als Streetworker arbeiten und es gibt Soziologen, die Selbsthilfegruppen leiten. Marc Boschwil ist auch Soziologe, aber er beschäftigt sich lieber mit Trends und hat gerade seine Diplomarbeit mit dem Titel "Luhmann in Jeans" fertigstellt. Die größte Leistung des Studenten der Universität Göttingen ist dabei die Konstruktion einer Trenduhr für Modeerscheinungen, mit der man hinreichend genau das Wiederaufflammen bestimmter Stile vorhersagen kann. So sieht er für das Jahr 2006 in der Sommermode ein Crossover-Revival aus Flowerpower- und Clubstyle-Klamotten vorher. Wie der Titel seiner demnächst als Taschenbuch veröffentlichten Abschlußarbeit schon vermuten läßt, bedient er sich der Wellenmetapher aus Niklas Luhmanns Systemtheorie, die besagt, daß sich die Geschichte in ihrer Intensität wie eine Welle fortsetzt.
Hier kommen einige fiktionale Nachrichten zum Auftakt:
.Gourmet-Gangsta
Rap und HipHop erfreuen sich bei den Teenies nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Dieser Umstand schlägt sich auch in wiederkehrenden hohen Charts-Plazierungen der einschlägigen Acts nieder. Einer dieser Pop-Promis ist LL Cool J, ganz nebenbei einer der Pioniere des Gangsta-Rap. Der hat kürzlich bei einem Vortrag an der Academy for Popular Music Research (APMR) in Boston über den Mangel an frischen, neuen Ideen in der auch von ihm gefüllten Musiksparte referiert: "Etwas wirklich Neues gab es seit fünf Jahren nicht mehr." Der Altmeister kritisierte nicht nur, sondern stellte auch gleich sein neues Projekt vor, das ohne Frage frischen Wind in die Szene der bösen Buben wehen wird. LL Cool J bringt im August dieses Jahres sein neues Album heraus, auf dem sich 14 gerappte Kochrezepte befinden werden. Die Tracklist mutet lecker an, finden sich doch Songtitel wie "Ghetto-Turkey à la Hollandaise" oder "I´ve Got Her Witta Halibut" wieder. Den Vogel schießt allerdings die erste Single ab - sie heißt "One Fork in My Knuckle of Pork". Guten Appetit.
.Rasieren ist passé
Frauen haben die Last des Kinderkriegens zu tragen, Männer müssen sich dagegen mindestens dreimal in der Woche rasieren. Am "Problem" der Schwangerschaft arbeitet die Gentechnik, doch die Sache mit dem Rasieren scheint bereits gelöst. Noch in diesem Jahr kommt eine neue Creme auf den Markt, die "Rasura" heißen und dem Mann das lästige Kürzen seines Bartwuchses ersparen soll. Das Wundermittel braucht nur jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, auf die Stoppeln aufgetragen und nach einer halben Stunde mit warmem Wasser abgewaschen zu werden. Der amerikanische Hersteller weist in der Produktbeschreibung darauf hin, daß es sich nicht um eine gewöhnliche Enthaarungscreme handle, sondern um eine Art chemische Rasur, bei der die Stoppeln zersetzt würden, ohne daß die feine Haut des männlichen Gesichtes dabei Schaden erleide.
. Absehbare Trends
Es gibt Soziologen, die als Streetworker arbeiten und es gibt Soziologen, die Selbsthilfegruppen leiten. Marc Boschwil ist auch Soziologe, aber er beschäftigt sich lieber mit Trends und hat gerade seine Diplomarbeit mit dem Titel "Luhmann in Jeans" fertigstellt. Die größte Leistung des Studenten der Universität Göttingen ist dabei die Konstruktion einer Trenduhr für Modeerscheinungen, mit der man hinreichend genau das Wiederaufflammen bestimmter Stile vorhersagen kann. So sieht er für das Jahr 2006 in der Sommermode ein Crossover-Revival aus Flowerpower- und Clubstyle-Klamotten vorher. Wie der Titel seiner demnächst als Taschenbuch veröffentlichten Abschlußarbeit schon vermuten läßt, bedient er sich der Wellenmetapher aus Niklas Luhmanns Systemtheorie, die besagt, daß sich die Geschichte in ihrer Intensität wie eine Welle fortsetzt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 8. Februar 2004
Literatur zu Medienfakes
herr denes, 22:44Uhr
"Ich bin Student der Journalistik und schreibe gerade meine Diplomarbeit. Kannst du mir vielleicht deine Magisterarbeit zuschicken?"
Das mache ich natürlich nicht. Ich verlange auch keine 40 Euro für eine *.pdf-Version, wie es einige Absolventen bei entsprechenden Internet-"Diensten" tun. Meine Magisterarbeit gibt es über Fernleihe in der Publizistik-Bibliothek der FU Berlin.
Neben den Auszügen auf dieser Website kann ich noch mit einer relativ ausführlichen Literaturliste zum Thema "Journalistische Fälschungen" dienen.
Baudrillard, Jean (1978): Agonie des Realen. Berlin: Merve.
Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (2002): Fakten und Fiktionen. Über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. 29. Band der Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Konstanz: UVK.
Bonfadelli, Heinz (1999): Medienwirkungsforschung. Band 1: Grundlagen und theoretische Perspektiven. Konstanz: UVK-Medien.
Born, Michael (1997): Wer einmal fälscht...: die Geschichte eines Fernseh-journalisten. Köln: Kiepenheuer und Witsch.
Boventer, Hermann (1985): Ethik des Journalismus. Konstanz: Universitätsverlag.
Brednich, Rolf Wilhelm (1990): Die Spinne in der Yucca-Palme: sagenhafte Geschichten von heute. München: Beck.
Buchwald, Manfred (1983): Die Nachrichtenexplosion. In: Franke, Lutz (Hrsg.): Die Medienzukunft. Frankfurt, S. 77f.
Buchwald, Manfred (1995): Ethische Aspekte der journalistischen Praxis. In: Winterhoff-Spurk, Peter/Hilpert, Konrad (Hrsg.): Medien & Ethik. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, S. 151-173.
Buonanno; Milly (Hrsg.) (2001): Eurofiction. Fiktionale Fernsehsendungen in Europa (dt. Übers.: Gabriele Kreutzner). Band 2 der Reihe Fiktion und Fiktionalisierung. Köln: Halem.
Burkart, Roland (2002): Kommunikationswissenschaft: Grundlagen und Problemfelder; Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft. Wien (u.a.): Böhlau.
Chill, Hanni/Meyn, Hermann (1998): Vielfalt und Aufgaben der Printmedien. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (1998): Massenmedien (Heft 260). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, Zugriff über http://www.bpb.de am 18. Juli 2003.
Corino, Karl (Hrsg.) (1986): Gefälscht! : Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik. Frankfurt am Main: Eichborn.
Debatin, Bernhard (1998): Ethik und Medien. Antworten auf zehn populäre Mißverständnisse über Medienethik. Zugriff über das „Netzwerk Medienethik“, http://www.gep.de/medienethik/netzeth1.htm am 16.11.2002.
Dietrich, Rainer (2002): Psycholinguistik. Stuttgart/Weimar: Metzler.
Doelker, Christian (1979): „Wirklichkeit“ in den Medien. Zürcher Beiträge zur Medienpädagogik. Zug: Klett & Balmer.
Duden-Verlag (2000): Wörterbuch der Szenesprachen. Hrsg: Peter Wippermann. Mannheim: Bibliographisches Institut.
Eco, Umberto (1987): Reise ins Reich der Hyperrealität. In: Eco, Umberto: Über Gott und die Welt. München: dtv, S. 35-71.
Eco, Umberto (1994): Einführung in die Semiotik. München: Fink.
Faulstich, Werner (2002): Einführung in die Medienwissenschaft. München: Fink.
Fedler, Fred (1989): Media Hoaxes. Ames, Iowa: Iowa State University Press.
Friedrichs, Jürgen (1993): Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Funiok, Rüdiger (Hrsg.) (1999): Medienethik, die Frage der Verantwortung. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. Zugriff über das „Netzwerk Medienethik“, http://www.gep.de/medienethik/netzeth1.htm am 16.11.2002.
Glasersfeld, Ernst von (1983): Einführung in den Radikalen Konstruktivismus. In: Watzlawick, Paul (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper, S. 17-40.
Görke, Alexander (2002): Unterhaltung als soziales System. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 63-73.
Göttlich, Udo/Nieland, Jörg-Uwe (1998): Daily Soaps als Umfeld von Marken, Moden und Trends: Von Seifenopern zu Lifestyle-Inszenierungen. In: Jäckel, Michael (Hrsg.): Die umworbene Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 179-208.
Goffman, Erving (1977): Rahmen-Analyse. Frankfurt: Suhrkamp.
Haas, Hannes (1999): Empirischer Journalismus. Verfahren zur Erkundung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.
Haller, Michael/Holzhey, Helmut (Hrsg.) (1992): Medien-Ethik. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Hohlfeld, Ralf (2002): Distinktionsversuche im Fernsehjournalismus. Das Verschwinden von Journalismus durch Inszenierung. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 101-113.
Kapferer, Jean-Noël (1997): Gerüchte: das älteste Massenmedium der Welt. Berlin: Aufbau Taschenbuchverlag.
Kepplinger, Hans-Mathias (1999): Die Mediatisierung der Politik. In: Wilke, Jürgen (Hrsg.) (1999): Massenmedien und Zeitgeschichte. Konstanz: UVK Medien, S. 55-63.
Kepplinger, Hans Mathias (2002): Die Kunst der Skandalierung und die Illusion der Wahrheit. München: Olzog.
Klaus, Elisabeth/Lünenborg, Margret (2002): Journalismus: Fakten, die unterhalten – Fiktionen, die Wirklichkeiten schaffen. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 152-164.
Kreimeier, Kurt (1997): Fingierter Dokumentarfilm und Strategien des Authentischen. In: Hoffmann, Kay (Hrsg.): Trau-Schau-Wem. Digitalisierung und dokumentarische Form. Konstanz: UVK, S. 29-46.
von La Roche, Walther (1992): Einführung in den praktischen Journalismus. München (u.a.): List.
Leschke, Rainer (2001): Einführung in die Medienethik. München: Fink.
Levinson, Stephen (1996): Relativity in spatial conception and description. In: Gumperz, Jay/Levinson, Stephen (Hrsg.) (1996): Rethinking linguistic relativity. Cambridge: Cambridge University Press , S. 177-202.
Loosen, Wiebke/Scholl, Achim (2002): Entgrenzungsphänomene im Journalismus. Entwurf einer theoretischen Konzeption und empirischer Fallstudien. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 139-151.
Mast, Claudia (1994): ABC des Journalismus: ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit. Konstanz: UVK-Medien Ölschläger.
Mayer, Horst Friedrich (Hrsg.) (1998): Die Entenmacher: wenn Medien in die Falle tappen. Wien (u.a.): Deuticke.
Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried (Hrsg.) (1995): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Merten, Klaus (1999): Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Münster: Lit.
Morgenthaler, Julia (2000): Facts oder Fiction? Eine Kommunikatorstudie zu den Determinanten für Fakes in Fernseh-Boulevardmagazinen. Bochum: Bochumer Univ.-Verlag.
Müller-Ullrich, Burkhard (1996): Medienmärchen: Gesinnungstäter im Journalismus. München: Blessing.
Neissl, Julia/Renger, Rudi (2002): Auf dem Weg zum „Journalismus light“? Zur Popularisierung des Journalismus in Österreich. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 254-270.
Nendza, Jürgen (1991): Wort und Fiktion. Eine Untersuchung zum Problem der Fiktionalität in der Sprachzeichenkommunikation. Dissertation an der TH Aachen.
Nieland, Jörg-Uwe (2002): Fiktionalisierung der politischen Kommunikation. Zwischen strategischem Kalkül und Entleerung der Politik. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 499-513.
Nowottny, Friedrich (1994): Die vierte Gewalt: Fragen an die Medien. Aachen: MM-Verlag.
Posner-Landsch, Marlene (2001): Wirtschaftsjournalismus und Storytelling. Nichts ist spannender als Wirtschaft. In: Krzeminski, Michael: Professionalität der Kommunikation. Medienberufe zwischen Auftrag und Autonomie. Köln: Halem, S. 83-95.
Prakke, Henk (1968): Kommunikation der Gesellschaft. Einführung in die funktionale Publizistik. Münster: Verlag Regensberg.
Ramonet, Ignacio (1999): Die Kommunikationsfalle. Macht und Mythen der Medien. Zürich: Rotpunktverlag.
Renger, Rudi (2000): Populärer Journalismus: Nachrichten zwischen Fakten und Fiktion. Innsbruck: Studien-Verlag.
Reus, Gunter (2002): „Zum Tanze freigegeben“. Fiktion im seriösen Journalismus - ein illegitimes Verhalten? In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 77-89.
Römer, Stefan (1998): Der Begriff des Fake. Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Ruhrmann, Georg (1995): Ereignis, Nachricht und Rezipient. In: Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried (Hrsg.) (1995), S. 237-255.
Sanes, Ken (1999): What's wrong with the Boston Globe and how to fix it. Zugriff über http://www.transparencynow.com/globewr.htm am 18.November 2002.
Schierl, Thomas (2002): Fiktion als funktionales Mittel werblicher Kommunikation. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 479-489.
Schmidt, Siegfried J. (1996): Die Welten der Medien. Grundlagen und Perspektiven der Medienbeobachtung. Braunschweig: Vieweg.
Schmidt/Weischenberg (1995): Mediengattungen, Berichterstattungsmuster, Darstellungsformen. In: Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried (Hrsg.) (1995), S. 212-235.
Schneider, Wolf (1984): Unsere tägliche Desinformation: wie die Massenmedien uns in die Irre führen. Hamburg: Gruner + Jahr.
Schneider, Wolf/Raue, Paul-Josef (1998): Handbuch des Journalismus. Hamburg: Rowohlt.
Schulz, Winfried (1989): Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien: Analyse der aktuellen Berichterstattung. Freiburg (u.a.): Alber.
Schwender, Clemens (2001): Fiktion als Probehandeln. Mentale Bedingungen der Medienwahrnehmung. In: Knilli, Friedrich/Matzker, Reiner/Zielinski, Siegfried (Hrsg.) (2000): Fiktion als Fakt. Bern: Lang, S. 147-166.
Sorkin, Michael (Hrsg.) (1992): Variations on a theme park: the new American city and the end of public space. New York: Hill and Wang.
Ueding, Gert (Hrsg.) (1996): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Tübingen: Niemeyer.
Ulfkotte, Udo (2001): So lügen Journalisten: der Kampf um Quoten und Auflagen. München: Bertelsmann.
Venus, Jochen (1997): Referenzlose Simulation?: Argumentationsstrukturen postmoderner Medientheorie am Beispiel von Jean Baudrillard. Würzburg: Königshausen und Neumann.
Voß, Peter (1998): Mündigkeit im Mediensystem - hat Medienethik eine Chance? Anmerkungen eines Verantwortlichen zur Theorie und zur Praxis der Massenmedien. Baden-Baden: Nomos-Verlags-Gesellschaft.
Watzlawick, Paul (Hrsg.) (1983): Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper.
Weber, Stefan (1998): Autopoeisis und Journalismus. Eine interaktive Studie. Salzburg: Universität Salzburg. Zugriff über http://www.sbg.ac.at/autojour/mail.htm am 1. Mai 2003.
Weber, Stefan (1999): Wie journalistische Wirklichkeiten entstehen. Salzburg: Schriftenreihe Journalistik des Kuratoriums für Journalistenausbildung, Band 15.
Weischenberg, Siegfried (1992): Journalistik. Medienkommunikation: Theorie und Praxis. Band 1: Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Westerbarkey, Joachim (2002): Täuschungen oder zur Unerträglichkeit ungeschminkter Wirklichkeiten. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 48-52.
Wolling, Jens (2002): Aufmerksamkeit durch Qualität? Empirische Befunde zum Verhältnis von Nachrichtenqualität und Nachrichtennutzung. In: Baum, Achim/ Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 202-216.
Zeitschriften- und Zeitungsartikel:
Bailey, Kenneth D. (1973): Monothetic and Polythetic Typologies and their Relation to Conceptualization, Measurement and Scaling. In: American Sociological Review, 38, S. 18-33.
Blech, Jörg/Lakotta, Beate (2000): Trubel um Trikots. In: Der Spiegel, 10.Januar 2000, S. 67.
Brandstetter, Günther/Weber, Stefan (1999): Medienjournalismus: Selbstreferenz als bloße Selbstreverenz? In: Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg (Hrsg.): Bericht zur Lage des Journalismus in Österreich Erhebungsjahr 1998. Salzburg: Universität Salzburg, S. 19-22.
Brosius, Hans Bernd: Schema-Theorie: ein brauchbarer Ansatz in der Wirkungsforschung? In: Publizistik, 3/1991, S. 285-297.
Cooke, Janet (1980): Jimmy’s World. In: Washington Post, 28. September 1980, Seite A1.
Ernst, Heiko (2000): Borderline-Journalismus. In: Message, Nr.3/2000, S. 64-67.
Franzetti, Dante (2000): Die Zukunft der Fakten. In: Die Zeit, Nr. 25/2000, 15. Juni, S. 49-50.
Gerbner, George (1956): Toward a general model of communication. In: Audiovisual Communication Review, No. 4/1956, S. 171-199.
Gehrs, Oliver (1998): Die Reporter vom Bahnhof Zoo. In: Berliner Zeitung, 27. November 1998, S. 19.
Glass, Stephen (1998): Hack Heaven. In: The New Republic, 18.Mai 1998, Seite 11.
Haller, Michael (2000): Medienfunktionen. In: Message, Nr.2/2000, S. 68-69.
Haller, Michael (2000a): Fakes. In: Message, Nr. 3/2000, S. 68-69.
Heidemann, Gerd/Walde, Thomas (1983): Wie Sternreporter Gerd Heidemann die Tagebücher fand. In: stern, 28. April 1983, S. 37L-37Z.
Heimbrecht, Jörg (2000): Gift in Textilien. ARD plusminus, 13.Januar 2000, Manuskript aus dem WDR-Onlinearchiv, http://www.ard.de/plusminus/archiv/ Zugriff am 18. Juni 2003.
Hickethier, Knut (2000): Geschichten aus 1001 Nacht. In: Message, Nr. 2/2000, S. 70-74.
Hoetzel, Holger (2000): „Frei erfunden“, „nie geführt“. In: Focus, 15.Mai 2000, S.220-222.
Hollersen, Wiebke (2002): Medienjournalismus – Bedauerlicher Einzelfall? In: Message, 4/2002, o.S..
Hunold, Gerfried W. (1994): Öffentlichkeit um jeden Preis? Überlegungen zu einer Ethik der Information. In: Forum Medienethik, Heft 1/1994, S. 6-18.
Jacobs, Hans-Jürgen (2003): Ende der Sicherheiten. Die „New York Times“ nimmt erneut Stellung in eigener Sache. In: Süddeutsche Zeitung, 8. Juni 2003, S. 23.
Kennedy, Dan (2003): News at the brink. In: The Phoenix, 23. Mai 2003, Zugriff über http://www.bostonphoenix.com/boston/news_features/dont_quote_me/multi-page/documents/02906111.htm , am 13. Juni 2003.
Kepplinger, Hans Mathias (1996): Inszenierte Wirklichkeiten. In: medien + erziehung, Heft 1/1996, S. 12-19.
Krause, Matthias B. (2003): Ein großes blaues Auge. Der Reporter Jayson Blair fälschte und fälschte – und die „New York Times“ druckte. In: Der Tagesspiegel, 13. Mai 2003, S. 19.
Kummer, Tom (1996): Wie bleiben Sie oben, Frau Stone? In: Süddeutsche Zeitung Magazin, 2.August 1996, S. 14-18.
Kurtz, Howard (2003): More Fabulists in Journalism. In: Washington Post, 12. Mai 2003, S. A2.
Laerum, Sabine (2000): Kein Stoff für Erzählungen. In: Message, Nr. 2/2000, S. 75-79.
Lesser, Gabriele (1998): Zeitungsente zu Weihnachten. In: die tageszeitung, 23. Dezember 1998, S. 11.
Minkmar, Nils (2000): Die Kummer-Fälschungen. Einzelfall oder Symptom? In: Die Zeit, Nr. 26/2000, 22. Juni, S. 36-37.
Minkmar, Nils (2000a): Der Fall Joseph und die Medien. Zwei Interviews zu der Frage, wie gute Absichten zu einem journalistischen und politischen Debakel führen konnten. In: Die Zeit, Nr. 50/2000, S. 47.
Norman, Trevor (2001): The Lovenstein-Report. In: The Guardian (London), 19. Juli 2001, Seite 6.
o.V. (1982): Hauptsache knallig. In: Der Spiegel, 13. September 1982, S. 68-73.
o.V. (1983): Honorare vom WDR für Rechtsextremisten. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Januar 1983, S. 4.
o.V. (1994): „Bitte sorge für die Transfers“. In: Focus, Nr. 23/1994, 6. Juni 1994, S. 54.
o.V. (1996): Als die Bilder lügen lernten. In: Süddeutsche Zeitung, 10. Februar 1996, S. 3&6.
o.V. (2002): Zug rast in Bahnwärterhaus. In: Der Tagesspiegel, 22. Juli 2002, S. 28.
o.V. (2002a): Rückzug des grünen Abgeordneten Cem Özdemir. In: Neue Zürcher Zeitung, 27. Juli 2002, S. 6.
o.V. (2002b): Associated Press Fires Reporter Over Quotes. In: Washington Post, 17. September 2002, S. C3.
o.V. (2003): Vor 20 Jahren: Seifenblase Hitler-Tagebücher. In: Stuttgarter Nachrichten, 19. April 2003, S. 26.
o.V. (2003a): „Blaues Auge“ für die „New York Times“. Ein journalistischer Skandal wird ausgebreitet. In: Neue Zürcher Zeitung, 13. Mai 2003, S. 4.
Peichl, Markus (2000): In: Minkmar, Nils (2000): Die Kummer-Fälschungen. Einzelfall oder Symptom? In: Die Zeit, Nr. 26/2000, 22. Juni, S. 36-37.
Rehren, Silke (2001): BILD, Trittin und der Schlagstock. Über den Umgang mit handwerklichen Fehlern. In: Journalistik-Journal, Nr.2/2001, Zugriff über http://www.journalistik-journal.de/archiv/2001-2/texte/rehren.htm am 22. Mai 2003.
Reichert, Steffen (2001): Fakes – Der verflogene Rauch. In: Message, Nr.2/2001, S. 65-66.
Schilde, Hans-Jürgen (1995): Interview mit Taslima Nasrin. In: Focus, 30. März 1995, o.S..
Schmidt-Polex, C. (1996): „Mit der Lüge leben“. In: Die Welt, 31. Mai 1996, S. 3.
Schneider, Wolf (1996): Wer liest denn schon noch die Tageszeitung? Rede am 3. September 1996 in Hannover. In: pressenews, Zugriff über http://www.pressetipp.de/rede.html am 20.06.2003.
Schwarz, Patrik (2001): Trittin sauer, Scharon sauer. In: die tageszeitung, 15. Dezember 2001, S. 7.
Schweitzer, Eva (2002): Besser lesbar. Ein Star-Reporter des „New York Times Magazine“ fälschte eine Geschichte. In: Berliner Zeitung, 25. Februar 2002, S. 17.
Shafer, Jack (2002): Christopher Newton’s Exclusive Talking Heads. In: Slate, 29. Oktober 2002, Zugriff über http://slate.msn.com/id/2073304, am 31.Mai 2003.
Sejna, Ralf (1996): Fernsehfälscher muss ins Gefängnis. In: Rhein-Zeitung, 17. Dezember 1996, S. 6.
Sonnenburg, Gisela (2003): Das schwarze Schaf im Wolfspelz. In: die tageszeitung, 7. Juni 2003, S. 16.
Stannies, Jan-Aslak (2000): Newsmaker. Enthüllungen am Strand. In: Message, Nr. 2/2000, S. 90-92.
Steffen, Robert/Geissman, Viktor (1995): „Pest“ in Indien 1994. Ein kritischer Rückblick. Medien verbreiteten Angst. In: Neue Zürcher Zeitung, 12. April 1995, S. 23.
Strupp, Joe (1999): Amparano fired from Arizona Republic for fake sources. In: Editor & Publisher, 26. August 1999, S. 4.
Terzani, Tiziano (1994): Indien. Stadt der Ratten. In: Der Spiegel, 2. Oktober 1994, S. 176-180.
Wallisch, Gianluca (2000): Kreative Wirklichkeit. In: Message, Nr. 2/2000, S. 84-89.
Wefing, Heinrich (2003): Der talentierte Mr. Blair. Gefälschte Berichte gefährden den Ruf der „New York Times“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Mai 2003, S. 37.
Weischenberg, Siegfried (2000): In: Minkmar, Nils (Verf.): Der Fall Joseph und die Medien. In: Die Zeit, Nr. 50, 14. Dezember. S. 47.
Wertheim, Jon (2002): „Who’s that girl?“ In: Sports Illustrated, 2.September 2002, Seite 24.
Winkler, Willi (2003): Zu gut. Fingierte Berichte beschäftigen die „New York Times“. In: Süddeutsche Zeitung, 12. Mai 2003, S. 17.
Wolf, Fritz (2000): Grenzgänger. In: Freitag, Nr. 27, 30. Juni 2000, S. 34.
Weitere Quellen im www:
Boston Phoenix: Letzter Zugriff über http://www.bostonphoenix.com/ am 13. Juni 2003.
Hessischer Rundfunk: service: familie. Letzter Zugriff über http://www.hr-online.de/fs/servicefamilie/archiv/030209.shtml am 10. Juni 2003.
Jo!Net: Letzter Zugriff über http://www.jonet.org am 17. Juli 2003.
Journalistik-Journal: Letzter Zugriff über http://www.journalistik-journal.de am 19. Juli 2003.
Michael Born. Letzter Zugriff über http://www.michaelborn.de am 12. Juni 2003.
The Museum of Hoaxes: Letzter Zugriff über http://www.museumofhoaxes.com am 16. Juli 2003.
Netzwerk Medienethik: Letzter Zugriff über http://www.gep.de/medienethik/ am 10. Juli 2003.
Slate, Letzter Zugriff über http://slate.msn.com am 20. Juli 2003.
Transparency: Letzter Zugriff über http://www.transparencynow.com am 17. Juli 2003.
Urban Legends Reference Page: Letzter Zugriff über http://www.urbanlegends.com am 17. Juli 2003.
Das mache ich natürlich nicht. Ich verlange auch keine 40 Euro für eine *.pdf-Version, wie es einige Absolventen bei entsprechenden Internet-"Diensten" tun. Meine Magisterarbeit gibt es über Fernleihe in der Publizistik-Bibliothek der FU Berlin.
Neben den Auszügen auf dieser Website kann ich noch mit einer relativ ausführlichen Literaturliste zum Thema "Journalistische Fälschungen" dienen.
Literatur
Monographien, Anthologien und Aufsätze:Baudrillard, Jean (1978): Agonie des Realen. Berlin: Merve.
Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (2002): Fakten und Fiktionen. Über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. 29. Band der Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Konstanz: UVK.
Bonfadelli, Heinz (1999): Medienwirkungsforschung. Band 1: Grundlagen und theoretische Perspektiven. Konstanz: UVK-Medien.
Born, Michael (1997): Wer einmal fälscht...: die Geschichte eines Fernseh-journalisten. Köln: Kiepenheuer und Witsch.
Boventer, Hermann (1985): Ethik des Journalismus. Konstanz: Universitätsverlag.
Brednich, Rolf Wilhelm (1990): Die Spinne in der Yucca-Palme: sagenhafte Geschichten von heute. München: Beck.
Buchwald, Manfred (1983): Die Nachrichtenexplosion. In: Franke, Lutz (Hrsg.): Die Medienzukunft. Frankfurt, S. 77f.
Buchwald, Manfred (1995): Ethische Aspekte der journalistischen Praxis. In: Winterhoff-Spurk, Peter/Hilpert, Konrad (Hrsg.): Medien & Ethik. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, S. 151-173.
Buonanno; Milly (Hrsg.) (2001): Eurofiction. Fiktionale Fernsehsendungen in Europa (dt. Übers.: Gabriele Kreutzner). Band 2 der Reihe Fiktion und Fiktionalisierung. Köln: Halem.
Burkart, Roland (2002): Kommunikationswissenschaft: Grundlagen und Problemfelder; Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft. Wien (u.a.): Böhlau.
Chill, Hanni/Meyn, Hermann (1998): Vielfalt und Aufgaben der Printmedien. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (1998): Massenmedien (Heft 260). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, Zugriff über http://www.bpb.de am 18. Juli 2003.
Corino, Karl (Hrsg.) (1986): Gefälscht! : Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik. Frankfurt am Main: Eichborn.
Debatin, Bernhard (1998): Ethik und Medien. Antworten auf zehn populäre Mißverständnisse über Medienethik. Zugriff über das „Netzwerk Medienethik“, http://www.gep.de/medienethik/netzeth1.htm am 16.11.2002.
Dietrich, Rainer (2002): Psycholinguistik. Stuttgart/Weimar: Metzler.
Doelker, Christian (1979): „Wirklichkeit“ in den Medien. Zürcher Beiträge zur Medienpädagogik. Zug: Klett & Balmer.
Duden-Verlag (2000): Wörterbuch der Szenesprachen. Hrsg: Peter Wippermann. Mannheim: Bibliographisches Institut.
Eco, Umberto (1987): Reise ins Reich der Hyperrealität. In: Eco, Umberto: Über Gott und die Welt. München: dtv, S. 35-71.
Eco, Umberto (1994): Einführung in die Semiotik. München: Fink.
Faulstich, Werner (2002): Einführung in die Medienwissenschaft. München: Fink.
Fedler, Fred (1989): Media Hoaxes. Ames, Iowa: Iowa State University Press.
Friedrichs, Jürgen (1993): Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Funiok, Rüdiger (Hrsg.) (1999): Medienethik, die Frage der Verantwortung. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. Zugriff über das „Netzwerk Medienethik“, http://www.gep.de/medienethik/netzeth1.htm am 16.11.2002.
Glasersfeld, Ernst von (1983): Einführung in den Radikalen Konstruktivismus. In: Watzlawick, Paul (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper, S. 17-40.
Görke, Alexander (2002): Unterhaltung als soziales System. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 63-73.
Göttlich, Udo/Nieland, Jörg-Uwe (1998): Daily Soaps als Umfeld von Marken, Moden und Trends: Von Seifenopern zu Lifestyle-Inszenierungen. In: Jäckel, Michael (Hrsg.): Die umworbene Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 179-208.
Goffman, Erving (1977): Rahmen-Analyse. Frankfurt: Suhrkamp.
Haas, Hannes (1999): Empirischer Journalismus. Verfahren zur Erkundung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.
Haller, Michael/Holzhey, Helmut (Hrsg.) (1992): Medien-Ethik. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Hohlfeld, Ralf (2002): Distinktionsversuche im Fernsehjournalismus. Das Verschwinden von Journalismus durch Inszenierung. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 101-113.
Kapferer, Jean-Noël (1997): Gerüchte: das älteste Massenmedium der Welt. Berlin: Aufbau Taschenbuchverlag.
Kepplinger, Hans-Mathias (1999): Die Mediatisierung der Politik. In: Wilke, Jürgen (Hrsg.) (1999): Massenmedien und Zeitgeschichte. Konstanz: UVK Medien, S. 55-63.
Kepplinger, Hans Mathias (2002): Die Kunst der Skandalierung und die Illusion der Wahrheit. München: Olzog.
Klaus, Elisabeth/Lünenborg, Margret (2002): Journalismus: Fakten, die unterhalten – Fiktionen, die Wirklichkeiten schaffen. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 152-164.
Kreimeier, Kurt (1997): Fingierter Dokumentarfilm und Strategien des Authentischen. In: Hoffmann, Kay (Hrsg.): Trau-Schau-Wem. Digitalisierung und dokumentarische Form. Konstanz: UVK, S. 29-46.
von La Roche, Walther (1992): Einführung in den praktischen Journalismus. München (u.a.): List.
Leschke, Rainer (2001): Einführung in die Medienethik. München: Fink.
Levinson, Stephen (1996): Relativity in spatial conception and description. In: Gumperz, Jay/Levinson, Stephen (Hrsg.) (1996): Rethinking linguistic relativity. Cambridge: Cambridge University Press , S. 177-202.
Loosen, Wiebke/Scholl, Achim (2002): Entgrenzungsphänomene im Journalismus. Entwurf einer theoretischen Konzeption und empirischer Fallstudien. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 139-151.
Mast, Claudia (1994): ABC des Journalismus: ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit. Konstanz: UVK-Medien Ölschläger.
Mayer, Horst Friedrich (Hrsg.) (1998): Die Entenmacher: wenn Medien in die Falle tappen. Wien (u.a.): Deuticke.
Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried (Hrsg.) (1995): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Merten, Klaus (1999): Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Münster: Lit.
Morgenthaler, Julia (2000): Facts oder Fiction? Eine Kommunikatorstudie zu den Determinanten für Fakes in Fernseh-Boulevardmagazinen. Bochum: Bochumer Univ.-Verlag.
Müller-Ullrich, Burkhard (1996): Medienmärchen: Gesinnungstäter im Journalismus. München: Blessing.
Neissl, Julia/Renger, Rudi (2002): Auf dem Weg zum „Journalismus light“? Zur Popularisierung des Journalismus in Österreich. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 254-270.
Nendza, Jürgen (1991): Wort und Fiktion. Eine Untersuchung zum Problem der Fiktionalität in der Sprachzeichenkommunikation. Dissertation an der TH Aachen.
Nieland, Jörg-Uwe (2002): Fiktionalisierung der politischen Kommunikation. Zwischen strategischem Kalkül und Entleerung der Politik. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 499-513.
Nowottny, Friedrich (1994): Die vierte Gewalt: Fragen an die Medien. Aachen: MM-Verlag.
Posner-Landsch, Marlene (2001): Wirtschaftsjournalismus und Storytelling. Nichts ist spannender als Wirtschaft. In: Krzeminski, Michael: Professionalität der Kommunikation. Medienberufe zwischen Auftrag und Autonomie. Köln: Halem, S. 83-95.
Prakke, Henk (1968): Kommunikation der Gesellschaft. Einführung in die funktionale Publizistik. Münster: Verlag Regensberg.
Ramonet, Ignacio (1999): Die Kommunikationsfalle. Macht und Mythen der Medien. Zürich: Rotpunktverlag.
Renger, Rudi (2000): Populärer Journalismus: Nachrichten zwischen Fakten und Fiktion. Innsbruck: Studien-Verlag.
Reus, Gunter (2002): „Zum Tanze freigegeben“. Fiktion im seriösen Journalismus - ein illegitimes Verhalten? In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 77-89.
Römer, Stefan (1998): Der Begriff des Fake. Dissertation an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Ruhrmann, Georg (1995): Ereignis, Nachricht und Rezipient. In: Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried (Hrsg.) (1995), S. 237-255.
Sanes, Ken (1999): What's wrong with the Boston Globe and how to fix it. Zugriff über http://www.transparencynow.com/globewr.htm am 18.November 2002.
Schierl, Thomas (2002): Fiktion als funktionales Mittel werblicher Kommunikation. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 479-489.
Schmidt, Siegfried J. (1996): Die Welten der Medien. Grundlagen und Perspektiven der Medienbeobachtung. Braunschweig: Vieweg.
Schmidt/Weischenberg (1995): Mediengattungen, Berichterstattungsmuster, Darstellungsformen. In: Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J./Weischenberg, Siegfried (Hrsg.) (1995), S. 212-235.
Schneider, Wolf (1984): Unsere tägliche Desinformation: wie die Massenmedien uns in die Irre führen. Hamburg: Gruner + Jahr.
Schneider, Wolf/Raue, Paul-Josef (1998): Handbuch des Journalismus. Hamburg: Rowohlt.
Schulz, Winfried (1989): Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien: Analyse der aktuellen Berichterstattung. Freiburg (u.a.): Alber.
Schwender, Clemens (2001): Fiktion als Probehandeln. Mentale Bedingungen der Medienwahrnehmung. In: Knilli, Friedrich/Matzker, Reiner/Zielinski, Siegfried (Hrsg.) (2000): Fiktion als Fakt. Bern: Lang, S. 147-166.
Sorkin, Michael (Hrsg.) (1992): Variations on a theme park: the new American city and the end of public space. New York: Hill and Wang.
Ueding, Gert (Hrsg.) (1996): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Tübingen: Niemeyer.
Ulfkotte, Udo (2001): So lügen Journalisten: der Kampf um Quoten und Auflagen. München: Bertelsmann.
Venus, Jochen (1997): Referenzlose Simulation?: Argumentationsstrukturen postmoderner Medientheorie am Beispiel von Jean Baudrillard. Würzburg: Königshausen und Neumann.
Voß, Peter (1998): Mündigkeit im Mediensystem - hat Medienethik eine Chance? Anmerkungen eines Verantwortlichen zur Theorie und zur Praxis der Massenmedien. Baden-Baden: Nomos-Verlags-Gesellschaft.
Watzlawick, Paul (Hrsg.) (1983): Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper.
Weber, Stefan (1998): Autopoeisis und Journalismus. Eine interaktive Studie. Salzburg: Universität Salzburg. Zugriff über http://www.sbg.ac.at/autojour/mail.htm am 1. Mai 2003.
Weber, Stefan (1999): Wie journalistische Wirklichkeiten entstehen. Salzburg: Schriftenreihe Journalistik des Kuratoriums für Journalistenausbildung, Band 15.
Weischenberg, Siegfried (1992): Journalistik. Medienkommunikation: Theorie und Praxis. Band 1: Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Westerbarkey, Joachim (2002): Täuschungen oder zur Unerträglichkeit ungeschminkter Wirklichkeiten. In: Baum, Achim/Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 48-52.
Wolling, Jens (2002): Aufmerksamkeit durch Qualität? Empirische Befunde zum Verhältnis von Nachrichtenqualität und Nachrichtennutzung. In: Baum, Achim/ Schmidt, Siegfried J. (2002), S. 202-216.
Zeitschriften- und Zeitungsartikel:
Bailey, Kenneth D. (1973): Monothetic and Polythetic Typologies and their Relation to Conceptualization, Measurement and Scaling. In: American Sociological Review, 38, S. 18-33.
Blech, Jörg/Lakotta, Beate (2000): Trubel um Trikots. In: Der Spiegel, 10.Januar 2000, S. 67.
Brandstetter, Günther/Weber, Stefan (1999): Medienjournalismus: Selbstreferenz als bloße Selbstreverenz? In: Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg (Hrsg.): Bericht zur Lage des Journalismus in Österreich Erhebungsjahr 1998. Salzburg: Universität Salzburg, S. 19-22.
Brosius, Hans Bernd: Schema-Theorie: ein brauchbarer Ansatz in der Wirkungsforschung? In: Publizistik, 3/1991, S. 285-297.
Cooke, Janet (1980): Jimmy’s World. In: Washington Post, 28. September 1980, Seite A1.
Ernst, Heiko (2000): Borderline-Journalismus. In: Message, Nr.3/2000, S. 64-67.
Franzetti, Dante (2000): Die Zukunft der Fakten. In: Die Zeit, Nr. 25/2000, 15. Juni, S. 49-50.
Gerbner, George (1956): Toward a general model of communication. In: Audiovisual Communication Review, No. 4/1956, S. 171-199.
Gehrs, Oliver (1998): Die Reporter vom Bahnhof Zoo. In: Berliner Zeitung, 27. November 1998, S. 19.
Glass, Stephen (1998): Hack Heaven. In: The New Republic, 18.Mai 1998, Seite 11.
Haller, Michael (2000): Medienfunktionen. In: Message, Nr.2/2000, S. 68-69.
Haller, Michael (2000a): Fakes. In: Message, Nr. 3/2000, S. 68-69.
Heidemann, Gerd/Walde, Thomas (1983): Wie Sternreporter Gerd Heidemann die Tagebücher fand. In: stern, 28. April 1983, S. 37L-37Z.
Heimbrecht, Jörg (2000): Gift in Textilien. ARD plusminus, 13.Januar 2000, Manuskript aus dem WDR-Onlinearchiv, http://www.ard.de/plusminus/archiv/ Zugriff am 18. Juni 2003.
Hickethier, Knut (2000): Geschichten aus 1001 Nacht. In: Message, Nr. 2/2000, S. 70-74.
Hoetzel, Holger (2000): „Frei erfunden“, „nie geführt“. In: Focus, 15.Mai 2000, S.220-222.
Hollersen, Wiebke (2002): Medienjournalismus – Bedauerlicher Einzelfall? In: Message, 4/2002, o.S..
Hunold, Gerfried W. (1994): Öffentlichkeit um jeden Preis? Überlegungen zu einer Ethik der Information. In: Forum Medienethik, Heft 1/1994, S. 6-18.
Jacobs, Hans-Jürgen (2003): Ende der Sicherheiten. Die „New York Times“ nimmt erneut Stellung in eigener Sache. In: Süddeutsche Zeitung, 8. Juni 2003, S. 23.
Kennedy, Dan (2003): News at the brink. In: The Phoenix, 23. Mai 2003, Zugriff über http://www.bostonphoenix.com/boston/news_features/dont_quote_me/multi-page/documents/02906111.htm , am 13. Juni 2003.
Kepplinger, Hans Mathias (1996): Inszenierte Wirklichkeiten. In: medien + erziehung, Heft 1/1996, S. 12-19.
Krause, Matthias B. (2003): Ein großes blaues Auge. Der Reporter Jayson Blair fälschte und fälschte – und die „New York Times“ druckte. In: Der Tagesspiegel, 13. Mai 2003, S. 19.
Kummer, Tom (1996): Wie bleiben Sie oben, Frau Stone? In: Süddeutsche Zeitung Magazin, 2.August 1996, S. 14-18.
Kurtz, Howard (2003): More Fabulists in Journalism. In: Washington Post, 12. Mai 2003, S. A2.
Laerum, Sabine (2000): Kein Stoff für Erzählungen. In: Message, Nr. 2/2000, S. 75-79.
Lesser, Gabriele (1998): Zeitungsente zu Weihnachten. In: die tageszeitung, 23. Dezember 1998, S. 11.
Minkmar, Nils (2000): Die Kummer-Fälschungen. Einzelfall oder Symptom? In: Die Zeit, Nr. 26/2000, 22. Juni, S. 36-37.
Minkmar, Nils (2000a): Der Fall Joseph und die Medien. Zwei Interviews zu der Frage, wie gute Absichten zu einem journalistischen und politischen Debakel führen konnten. In: Die Zeit, Nr. 50/2000, S. 47.
Norman, Trevor (2001): The Lovenstein-Report. In: The Guardian (London), 19. Juli 2001, Seite 6.
o.V. (1982): Hauptsache knallig. In: Der Spiegel, 13. September 1982, S. 68-73.
o.V. (1983): Honorare vom WDR für Rechtsextremisten. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Januar 1983, S. 4.
o.V. (1994): „Bitte sorge für die Transfers“. In: Focus, Nr. 23/1994, 6. Juni 1994, S. 54.
o.V. (1996): Als die Bilder lügen lernten. In: Süddeutsche Zeitung, 10. Februar 1996, S. 3&6.
o.V. (2002): Zug rast in Bahnwärterhaus. In: Der Tagesspiegel, 22. Juli 2002, S. 28.
o.V. (2002a): Rückzug des grünen Abgeordneten Cem Özdemir. In: Neue Zürcher Zeitung, 27. Juli 2002, S. 6.
o.V. (2002b): Associated Press Fires Reporter Over Quotes. In: Washington Post, 17. September 2002, S. C3.
o.V. (2003): Vor 20 Jahren: Seifenblase Hitler-Tagebücher. In: Stuttgarter Nachrichten, 19. April 2003, S. 26.
o.V. (2003a): „Blaues Auge“ für die „New York Times“. Ein journalistischer Skandal wird ausgebreitet. In: Neue Zürcher Zeitung, 13. Mai 2003, S. 4.
Peichl, Markus (2000): In: Minkmar, Nils (2000): Die Kummer-Fälschungen. Einzelfall oder Symptom? In: Die Zeit, Nr. 26/2000, 22. Juni, S. 36-37.
Rehren, Silke (2001): BILD, Trittin und der Schlagstock. Über den Umgang mit handwerklichen Fehlern. In: Journalistik-Journal, Nr.2/2001, Zugriff über http://www.journalistik-journal.de/archiv/2001-2/texte/rehren.htm am 22. Mai 2003.
Reichert, Steffen (2001): Fakes – Der verflogene Rauch. In: Message, Nr.2/2001, S. 65-66.
Schilde, Hans-Jürgen (1995): Interview mit Taslima Nasrin. In: Focus, 30. März 1995, o.S..
Schmidt-Polex, C. (1996): „Mit der Lüge leben“. In: Die Welt, 31. Mai 1996, S. 3.
Schneider, Wolf (1996): Wer liest denn schon noch die Tageszeitung? Rede am 3. September 1996 in Hannover. In: pressenews, Zugriff über http://www.pressetipp.de/rede.html am 20.06.2003.
Schwarz, Patrik (2001): Trittin sauer, Scharon sauer. In: die tageszeitung, 15. Dezember 2001, S. 7.
Schweitzer, Eva (2002): Besser lesbar. Ein Star-Reporter des „New York Times Magazine“ fälschte eine Geschichte. In: Berliner Zeitung, 25. Februar 2002, S. 17.
Shafer, Jack (2002): Christopher Newton’s Exclusive Talking Heads. In: Slate, 29. Oktober 2002, Zugriff über http://slate.msn.com/id/2073304, am 31.Mai 2003.
Sejna, Ralf (1996): Fernsehfälscher muss ins Gefängnis. In: Rhein-Zeitung, 17. Dezember 1996, S. 6.
Sonnenburg, Gisela (2003): Das schwarze Schaf im Wolfspelz. In: die tageszeitung, 7. Juni 2003, S. 16.
Stannies, Jan-Aslak (2000): Newsmaker. Enthüllungen am Strand. In: Message, Nr. 2/2000, S. 90-92.
Steffen, Robert/Geissman, Viktor (1995): „Pest“ in Indien 1994. Ein kritischer Rückblick. Medien verbreiteten Angst. In: Neue Zürcher Zeitung, 12. April 1995, S. 23.
Strupp, Joe (1999): Amparano fired from Arizona Republic for fake sources. In: Editor & Publisher, 26. August 1999, S. 4.
Terzani, Tiziano (1994): Indien. Stadt der Ratten. In: Der Spiegel, 2. Oktober 1994, S. 176-180.
Wallisch, Gianluca (2000): Kreative Wirklichkeit. In: Message, Nr. 2/2000, S. 84-89.
Wefing, Heinrich (2003): Der talentierte Mr. Blair. Gefälschte Berichte gefährden den Ruf der „New York Times“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Mai 2003, S. 37.
Weischenberg, Siegfried (2000): In: Minkmar, Nils (Verf.): Der Fall Joseph und die Medien. In: Die Zeit, Nr. 50, 14. Dezember. S. 47.
Wertheim, Jon (2002): „Who’s that girl?“ In: Sports Illustrated, 2.September 2002, Seite 24.
Winkler, Willi (2003): Zu gut. Fingierte Berichte beschäftigen die „New York Times“. In: Süddeutsche Zeitung, 12. Mai 2003, S. 17.
Wolf, Fritz (2000): Grenzgänger. In: Freitag, Nr. 27, 30. Juni 2000, S. 34.
Weitere Quellen im www:
Boston Phoenix: Letzter Zugriff über http://www.bostonphoenix.com/ am 13. Juni 2003.
Hessischer Rundfunk: service: familie. Letzter Zugriff über http://www.hr-online.de/fs/servicefamilie/archiv/030209.shtml am 10. Juni 2003.
Jo!Net: Letzter Zugriff über http://www.jonet.org am 17. Juli 2003.
Journalistik-Journal: Letzter Zugriff über http://www.journalistik-journal.de am 19. Juli 2003.
Michael Born. Letzter Zugriff über http://www.michaelborn.de am 12. Juni 2003.
The Museum of Hoaxes: Letzter Zugriff über http://www.museumofhoaxes.com am 16. Juli 2003.
Netzwerk Medienethik: Letzter Zugriff über http://www.gep.de/medienethik/ am 10. Juli 2003.
Slate, Letzter Zugriff über http://slate.msn.com am 20. Juli 2003.
Transparency: Letzter Zugriff über http://www.transparencynow.com am 17. Juli 2003.
Urban Legends Reference Page: Letzter Zugriff über http://www.urbanlegends.com am 17. Juli 2003.
... link
Medienfake-Typologie
herr denes, 22:25Uhr
Michael Born ist nicht gleich Tom Kummer und Janet Cooke nicht gleich Marie-Monique Robin. Was diese vier Journalisten gemeinsam haben? Ein Fake; sie wurde jeweils dadurch bekannt, dass sie einen Beitrag (manche sogar mehrere) veröffentlicht haben, in dem sie erfunden oder gelogen haben. Für viele Medienbeobachter gehören sie damit in einen Topf, zur Paria eines ethischen Standards verpflichteten Berufsstandes. Doch Gleichmacherei hilft nicht bei der Ursachenforschung und deswegen enthält meine Magisterarbeit eine Typologie journalistischer Fakes.
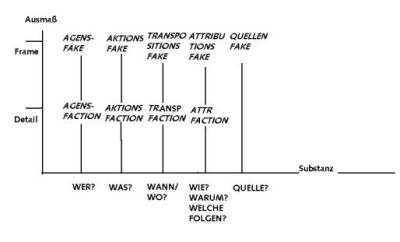
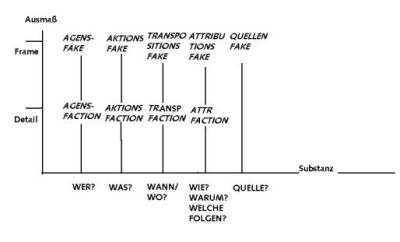
... link
Zwischenstand
herr denes, 02:07Uhr
Hallohurra. Ich darf mich "M.A. der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und der Germanistischen Linguistik" schimpfen. Magister der Pukgerling. Meister der Kommunikation im Großen und im Kleinen.
Deswegen bin ich auch in der Lage, die Zusammenführung des Weblogs mit meiner Website voranzutreiben. (siehe Navigation)
Enttäuscht bin ich über die Resonanz auf meinen Aufruf zu » "Zu wahr für alle
! Also...
Deswegen bin ich auch in der Lage, die Zusammenführung des Weblogs mit meiner Website voranzutreiben. (siehe Navigation)
Enttäuscht bin ich über die Resonanz auf meinen Aufruf zu » "Zu wahr für alle
! Also...
... link (0 Kommentare) ... comment
Behandelte Themen
herr denes, 01:56Uhr
"Mehr als nur Content" lautet eine meiner Devisen. Gute Themen sind solche, die sich vom Einheitsbrei des Aufmerksamkeitszwangjournalismus abheben, die sich so verarbeiten lassen, dass der Leser, Hörer oder Zuschauer auch nach dem ersten Absatz noch das Interesse daran hat, das mit vielen Teasern aufgebaut wurde. Mehr noch: Gute Themen brauchen keine Teaser.
Ob ich diesem Anspruch bislang gerecht werden konnte, müssen andere beurteilen, hier kommt zur Einschätzung die Übersicht einiger von mir behandelter Themen:
Print-Magazine
 "Isch schwör...!" New German Pidgin, die Evaluation eines Deutsch-Türkischen Mischcodes. (1999)
"Isch schwör...!" New German Pidgin, die Evaluation eines Deutsch-Türkischen Mischcodes. (1999)
 "Polybandie" Der Trend zur Drittband. Über Norman Cook, Mike Patton und andere polygame Musiker. (1999)
"Polybandie" Der Trend zur Drittband. Über Norman Cook, Mike Patton und andere polygame Musiker. (1999)
 "Von Kaffeetassen und deutschen Schäferhunden." Unterwegs mit einem Hoteltesterteam in Berlin. (2002)
"Von Kaffeetassen und deutschen Schäferhunden." Unterwegs mit einem Hoteltesterteam in Berlin. (2002)
 "Der Zwischenfall" Mitten in Berlin: Ein Mann rutscht zwischen Zug und Bahnsteigkante. Und stirbt daran. (1998/2001)
"Der Zwischenfall" Mitten in Berlin: Ein Mann rutscht zwischen Zug und Bahnsteigkante. Und stirbt daran. (1998/2001)
 "Schlagfertigkeit = Vorher wissen, was passiert." Über die wachsende Bedeutung der Antizipationsforschung in der Kommunikation.
"Schlagfertigkeit = Vorher wissen, was passiert." Über die wachsende Bedeutung der Antizipationsforschung in der Kommunikation.
 "No more 9-to-5" Zeitumstellung bei der biologischen Uhr. Der Mensch lebt zunehmend "später". (2002)
"No more 9-to-5" Zeitumstellung bei der biologischen Uhr. Der Mensch lebt zunehmend "später". (2002)
 "Das Phantom" Über Trent Reznor, den Kopf der Band Nine Inch Nails und die Konsequenz einer Selbstinszenierung im Allgemeinen. (1999)
"Das Phantom" Über Trent Reznor, den Kopf der Band Nine Inch Nails und die Konsequenz einer Selbstinszenierung im Allgemeinen. (1999)
 Interviews u.a. mit Underworld, Lemonbabies, Waltari, Alexi Lalas, Rammstein.
Interviews u.a. mit Underworld, Lemonbabies, Waltari, Alexi Lalas, Rammstein.
Radio
 "Und dann hatte ich einfach nichts mehr..." Christian H. aus Hannover. Wie ein Blinder Radio hört und dazu Keyboard spielt. (1997)
"Und dann hatte ich einfach nichts mehr..." Christian H. aus Hannover. Wie ein Blinder Radio hört und dazu Keyboard spielt. (1997)
 "Regen" Eine Stunde Tristesse. Oder warum Regenschirmträger die grimmigeren Passanten sind.(1996)
"Regen" Eine Stunde Tristesse. Oder warum Regenschirmträger die grimmigeren Passanten sind.(1996)
 "Name-walking" Wie die Straßen zu ihren Namen kommen und warum das a bei Hausnummern manchmal groß und manchmal klein geschrieben wird. (1997)
"Name-walking" Wie die Straßen zu ihren Namen kommen und warum das a bei Hausnummern manchmal groß und manchmal klein geschrieben wird. (1997)
 "Stigma Legasthenie" Interview mit der Psychologin Hannelore Schermeleh-Solbrig über Legastheniker, Dyslektiker und andere Lese-Rechtschreib-Geschwächte. (1997)
"Stigma Legasthenie" Interview mit der Psychologin Hannelore Schermeleh-Solbrig über Legastheniker, Dyslektiker und andere Lese-Rechtschreib-Geschwächte. (1997)
 Interview u.a. mit Peter Lustig (Löwenzahn).
Interview u.a. mit Peter Lustig (Löwenzahn).
Online
 "Wie sag ich's meinem Teenie?" Poplyrics im Mainstream des ausgehenden 20.Jahrhunderts. (1999)
"Wie sag ich's meinem Teenie?" Poplyrics im Mainstream des ausgehenden 20.Jahrhunderts. (1999)
 "Access-Infarkt" Verschwörungstheorie über vierstellige Zugangscodes. (2000)
"Access-Infarkt" Verschwörungstheorie über vierstellige Zugangscodes. (2000)
 "Windhunde im Portfolio" Über die durch das www neu gewonnene Cyber-Ästhetik des Schmuddelressorts Sportwetten. (2002)
"Windhunde im Portfolio" Über die durch das www neu gewonnene Cyber-Ästhetik des Schmuddelressorts Sportwetten. (2002)
 Reviews u.a. zu Tool, Fetish, The Gathering, Waltari, Fear Factory, Muse, Suburban Tribe, Alessandro Baricco, David Lynch's "Straight Story".
Reviews u.a. zu Tool, Fetish, The Gathering, Waltari, Fear Factory, Muse, Suburban Tribe, Alessandro Baricco, David Lynch's "Straight Story".
 Betreuung des Specials "Finweek" (2001), Ressortleitung ("FACTION").
Betreuung des Specials "Finweek" (2001), Ressortleitung ("FACTION").
Volontariat
 Reportagen über
Reportagen über
 Beiträge über
Beiträge über
Ob ich diesem Anspruch bislang gerecht werden konnte, müssen andere beurteilen, hier kommt zur Einschätzung die Übersicht einiger von mir behandelter Themen:
Print-Magazine
Radio
Online
Volontariat
- "VIP für einen Abend - mit dem Limousinenservice durch Berlin";
"Hobby Musik";
"Afrika-Cup in Berlin".
- "Plötzlicher Herztod im Sport";
"Touri-Steuer für Berlin?";
"Brandeburg auf der Grünen Woche" (Ü-Wagen).
... link
Jobs
herr denes, 01:47Uhr
Ich bin Volontär an der ems - ELECTRONIC MEDIA SCHOOL/SCHULE FÜR ELEKTRONISCHE MEDIEN in Potsdam-Babelsberg. Das Volontariat dauert noch bis zum Frühjahr 2005.

So schaue ich meistens, wenn ich in der Journalistenschule bin. Man nennt es: An seine Grenzen stoßen....
Acht [lange] Jahre war ich davor als Nachtzugbegleiter aktiv. Liegewagen, Schlafwagen, Reiseleiter, Zugschaffner.
Das war prägend. Und hat auch manchmal Spaß gemacht.

Über das Zugfahren habe ich einmal ein Essay geschrieben:
Trainwalk [partiell fiktional - wie so vieles im Leben]
Rot und weiß angestrichen, 26,4 Meter lang, 1967 gebaut, 1998 modernisiert,. 33 Betten oder alternativ 33 Sitze, ein Gang aus Holzfurnitur mit 14 Türen. Mein Arbeitsplatz ist seit sechs Jahren eine fahrende Hoteleinrichtung wie es die Gewerkschaft ausdrückt. Schlafwagenschaffner ist einer dieser Jobs, mit denen man als Student angeben kann, weil er für die meisten Gesprächspartner die Symbiose aus Herumkommen, Menschen kennenlernen und frei sein verkörpert. Mit Freiheit fangen meine Fahrten nie an, es ist mehr die Vorbereitung eines Schauspielers auf eine Theateraufführung, die ich im Betriebsbahnhof erledige. Nur mit sehr viel mehr Schweiß verbunden, als wolle jeder Tropfen meine intellektuelle Auslegung dieser Tätigkeit trüben. Ich habe Gurte arretiert, Betten kontrolliert, Wäsche gezählt, Kaffee ge-kocht und Sanitäranlagen instandgesetzt, als sich das Rangierobjekt (ein Zug, der noch keine Gäste hat) in Richtung Abfahrtsbahnhof in Bewegung setzt. Erst kurz vorher zog ich mein Ehrenkleid samt Fliege an, bereitete meine so wichtig aussehende Schreibmappe vor, die Formulare erhält, über die ich bei jedem Bezirksämtler lachen würde, machte mich fertig für den ersten Kontakt mit meinen Kunden.
Hinfahrt - der Abend
Ein paar Stunden später sind die Leiden publikumsloser Schufterei vergessen. Jedes Bücken, jeder Gang durch den Wagen und natürlich jedes herausgeklappte Bett dürfen ihre Wirkung nicht verfehlen : Respekt, Mitleid und Unverständnis. Für die extreme Verbindung unterschiedlichster Tätigkeiten. „Der Schlafwagenschaffner - ein Mann mit 73 Berufen“, prangte es in einem der Wagen von einem Zettel, der im Dienstabteil hing. „Kellner, Hotelier, Seelsorger, Drogist, Koch“, eine Auswahl dieses trefflichen Pamphlets, daß mit seinem knallorange-sofabraunem Outfit eindeutig den Siebzigern entsprungen sein mußte. Es stammte also aus der Zeit, in der man als Schaffner „noch wer war, Geld hatte“, wie mein Kollege Peter immer zu erzählen weiß. „Damals, vor zwanzig Jahren, standen die Leute noch mit Hundertmarkscheinen am Bahnhof Zoo und bettelten darum, mitgenommen zu werden.“ Besser, daß ich diese Zeiten in Deutschlands Nachtzügen nie miterleben durfte, sonst würde ich kaum eine dieser würdeloser Situationen, wie sie sich auch auf dieser Fahrt nach Mittelitalien abspielen, ohne eine Gastbeschwerde überstehen. Es sind diese vierzig bis hundert Sekunden, in denen die Gäste vor ihrem Abteil stehen, einen dabei beobachten, wie man ihre Betten aus der Wand holt und arretiert und sich genötigt fühlen, mit einem zu sprechen. Die Nötigung geht meist vom Schaffner selber aus, weil es die größte Chance ist, ein persönliches Verhältnis zum Gast aufzubauen und damit den Wiedererkennungswert, die Sicherung von Zufriedenheit und Spendabilität, zu erhöhen. So gut diese Überbrückungsgespräche über das Urlaubsziel, den Retriever oder die Blasenschwäche des nun auch schon wieder strullenden Ehegatten auch laufen können, entstehen beim Scheitern des Small-Talks unendlich lang erscheinende Sekunden des Schweigens auf der Schneide zwischen meiner Trinkgelderwartung und dem Geiz der Spielverderber. Die hohe Kunst, den Gast von der eigenen intellektuellen Überqualifikation für diese Arbeit zu überzeugen, wird bei Vollendung oft genug entlohnt, deswegen muß ich das Risiko schweigender Penetration immer in Kauf nehmen. Wieder und wieder, zwischen schnellen Bieren und verdrießlichen Snacks, elf Abteile - 25 Gäste lang. Es ist nicht allein Profitgier, die den Schaffner zum Entertainer macht, es ist auch der Wunsch, aus der Routine auszubrechen. Man ist am Arbeitsplatz gefangen, macht auf jeder Fahrt das Gleiche und weiß, daß man einen an sich guten Job erwischt hat. Das kann einen verrückt machen, wenn man sich nicht ein Spielchen sucht. Und abends auf der Hinfahrt ist mein Spiel das Tip-Samen-Sähen. Nach zwei Stunden legt sich der Trubel, alle Betten sind umgeklappt, die Papiere schnell geschrieben. Die erste Zigarette schmeckt wie nach einer opulenten Mahlzeit, ein Schluck aus der Flasche mit dem inzwischen schalen Begrüßungssekt spendet neuen Arbeitsmut. Und meistens kommt gerade in diesem Augenblick einer dieser netten Mittsechziger Ehemänner. „Haben Sie ´nen Klaren ? Ich zahl´den gleich, brauchen Sie nicht auf die Rechnung zu schreiben ! Danke, sagen Sie, fahren Sie bis nach Italien mit ? Ach, und gleich wieder zurück ? Aber Sie haben ja Pause, naja, vier Stunden immerhin. Mein Neffe hat neben dem Studium als Nachtportier gearbeit, der hatte eigentlich den gleichen Job wie Sie, haha. Haben Sie noch einen ? Danke, zahl´ ich wieder sofort, schön kalt das Zeug. Wir fahren schon seit sechzehn Jahren mit diesem Zug, aber Sie sind wirklich der netteste Schaffner. Wissen Sie, meine Frau, die meckert, wenn ich im Urlaub trinke, aber ich fahr ja jetzt noch nicht mit dem Auto. Ihre Freundin ist auch nicht sehr begeistert über die Fahrerei, was? Naja, die Weiber, man kennt sie ja. Was trinken Sie ? Ach so, nicht im Dienst, aber Sie können doch auch ´n bißchen schlafen, kommen Sie, ich geb´ Ihnen einen aus. So, genau, zwei Klare und der Rest ist für Sie !“ Wenn diese Viertelstunde dann überstanden ist, hat man meist schon wieder das Geld eingenommen, das man auf der Fahrt ausgibt. Schaffner - Beruf Nr.62: Barkeeper. Allerdings mit der Besonderheit, daß man den Gast (zusammen mit seiner Frau) am nächsten Morgen wieder sieht. Meine Diskretion lassen sich diese meine Lieblingsgäste oft einiges kosten, als Gegenleistung gebe ich meinem Kunden das Gefühl, er sei der Einzige, mit dem ich solch ein „Privatgespräch“ überhaupt führen würde. Jetzt kann ich zufrieden die Frühstücke für den nächsten Morgen vorbereiten, mit den Kollegen quatschen, etwas Musik hören und mich für ein paar Stunden auf die Pritsche legen. Die Pritsche, so nennen Schaffner, die sich gerne der Fernfahrerterminologie bedienen, jenes etwa Eins-Vierzig lange Verlängerungsstück zum Schaffnersitz am Ende des Ganges, das zu einer Liege ausgeklappt werden kann, deren größter Fehler die Positionierung vor einer der beiden Waggontoiletten ist. Ich habe ´mal ein Essay über die unterschiedlichen Nebengeräusche des Wasserlassens bei Mann und Frau verfasst, dieses dann aber verloren. Es war sehr treffend formuliert und trug eine gewichtige soziokulturelle Komponente.
Hinfahrt - der Morgen
Es spielt überhaupt keine Rolle, wann ein Schlaf- und Liegewagenzug sein Ziel erreicht, mindestens zwei Abteile sind immer schon um fünf Uhr wach. Sie rütteln am schnarchenden Schaffner, der nach Stunden endlich eine erträgliche Stellung auf der Pritsche gefunden hat, um für eine Stunde einzunicken. „Haha, Sie sind ja eingeschlafen !“, wie vom Triumph eines Lehrers, der einen Abschreiber erwischt hat, ermuntert, kommt der Vorschlag zur Wiedergutmachung prompt : „Können wir schon Kaffee haben ?“ Am Morgen hat der Job wenig von Schauspielerei, höchstens man versetzt sich in die Rolle einer gestreßten Bedienung in einem überfüllten Straßencafé an der Piazza Navona. Jeder Gast kriegt ein Frühstück samt durchaus erträglichem Kaffee, Tee oder Kakao. Frische Brötchen nahm der Zug Nachts auf den Weg an die Rivieraküste mit. Jetzt bleibt nicht viel Zeit zur Gipfelschau in den vorbeirasenden Südalpen, denn auch wenn wir unser Ziel erst am Mittag erreichen, werden alle Gäste zwischen Acht und Neun Uhr ihre Sitze wiederhaben und ihr Frühstück vorgesetzt bekommen wollen. Wenn die Körbchen Teller und Tassen fertig sind, kann die nervliche Leistungsshow beginnen. „Hallo !“, tönt es aus der 32. „Haben Sie noch ein bißchen Kaffee ?“ Die gierigen Blicke des älteren Ehepaars aus dem Nebenabteil verheißen ebenfalls nicht Gutes. „Denken Sie noch an uns ?“ Was, die hatten doch schon ihre ersten Tassen ? Meine Argumentation muß sitzen. „Wissen Sie, das ist wie zu Kriegszeiten, erst kriegt jeder einmal und dann gibt´s den Nachschlag.“ „Ja“, antwortet der tatsächlich kriegserprobte Gast eingeschüchtert, „ich wollte ja nur noch einmal nachfragen !“ Typisch, erst brauchen sie ´ne halbe Stunde, um wach zu werdenund dann können sie sich keine fünf Minuten gedulden. Und dann dieser freche Bengel, von 15 Stunden Fahrzeit Drei Stunden auf dem Gang toben, brüllen, stören- scheiß antiautoritäre Erziehung. „Läßt Du mich ´mal vorbei ?“ „Kevin, mein Schatz, läßt Du den Onkel mal vorbei ?“ Vielen Dank, inzwischen bin ich längst in der 51, um die Betten einzuklappen. Fließt der Schweiß, gilt es, die optische Gunst der Stunde zu nutzen. „Haben Sie gut geschlafen ?“; vorgetäuschte Anteilnahme als trinkgeldfördernde Maßnahme, die Antwort als unvermeidliche Konsequenz. „Ach, an und für sich ist es schon sehr ungewohnt, also im ICC schläft man besser !“ „Was Sie nicht sagen - ich wußte gar nicht, daß der ICE nachts fährt ?“ „Doch, der ICC fährt nachts.“ Eine Tür weiter die nächste Grausamkeit: „So, jetzt dürfen Sie auch bei uns die Betten machen und das Frühstück bringen. Sind wir eigentlich pünktliche ?“ „Nein, wir haben drei Minuten Verspätung !“ „Oh, aber das ist doch nicht so dramatisch ?“

So schaue ich meistens, wenn ich in der Journalistenschule bin. Man nennt es: An seine Grenzen stoßen....
Acht [lange] Jahre war ich davor als Nachtzugbegleiter aktiv. Liegewagen, Schlafwagen, Reiseleiter, Zugschaffner.
Das war prägend. Und hat auch manchmal Spaß gemacht.

Über das Zugfahren habe ich einmal ein Essay geschrieben:
Trainwalk [partiell fiktional - wie so vieles im Leben]
Rot und weiß angestrichen, 26,4 Meter lang, 1967 gebaut, 1998 modernisiert,. 33 Betten oder alternativ 33 Sitze, ein Gang aus Holzfurnitur mit 14 Türen. Mein Arbeitsplatz ist seit sechs Jahren eine fahrende Hoteleinrichtung wie es die Gewerkschaft ausdrückt. Schlafwagenschaffner ist einer dieser Jobs, mit denen man als Student angeben kann, weil er für die meisten Gesprächspartner die Symbiose aus Herumkommen, Menschen kennenlernen und frei sein verkörpert. Mit Freiheit fangen meine Fahrten nie an, es ist mehr die Vorbereitung eines Schauspielers auf eine Theateraufführung, die ich im Betriebsbahnhof erledige. Nur mit sehr viel mehr Schweiß verbunden, als wolle jeder Tropfen meine intellektuelle Auslegung dieser Tätigkeit trüben. Ich habe Gurte arretiert, Betten kontrolliert, Wäsche gezählt, Kaffee ge-kocht und Sanitäranlagen instandgesetzt, als sich das Rangierobjekt (ein Zug, der noch keine Gäste hat) in Richtung Abfahrtsbahnhof in Bewegung setzt. Erst kurz vorher zog ich mein Ehrenkleid samt Fliege an, bereitete meine so wichtig aussehende Schreibmappe vor, die Formulare erhält, über die ich bei jedem Bezirksämtler lachen würde, machte mich fertig für den ersten Kontakt mit meinen Kunden.
Hinfahrt - der Abend
Ein paar Stunden später sind die Leiden publikumsloser Schufterei vergessen. Jedes Bücken, jeder Gang durch den Wagen und natürlich jedes herausgeklappte Bett dürfen ihre Wirkung nicht verfehlen : Respekt, Mitleid und Unverständnis. Für die extreme Verbindung unterschiedlichster Tätigkeiten. „Der Schlafwagenschaffner - ein Mann mit 73 Berufen“, prangte es in einem der Wagen von einem Zettel, der im Dienstabteil hing. „Kellner, Hotelier, Seelsorger, Drogist, Koch“, eine Auswahl dieses trefflichen Pamphlets, daß mit seinem knallorange-sofabraunem Outfit eindeutig den Siebzigern entsprungen sein mußte. Es stammte also aus der Zeit, in der man als Schaffner „noch wer war, Geld hatte“, wie mein Kollege Peter immer zu erzählen weiß. „Damals, vor zwanzig Jahren, standen die Leute noch mit Hundertmarkscheinen am Bahnhof Zoo und bettelten darum, mitgenommen zu werden.“ Besser, daß ich diese Zeiten in Deutschlands Nachtzügen nie miterleben durfte, sonst würde ich kaum eine dieser würdeloser Situationen, wie sie sich auch auf dieser Fahrt nach Mittelitalien abspielen, ohne eine Gastbeschwerde überstehen. Es sind diese vierzig bis hundert Sekunden, in denen die Gäste vor ihrem Abteil stehen, einen dabei beobachten, wie man ihre Betten aus der Wand holt und arretiert und sich genötigt fühlen, mit einem zu sprechen. Die Nötigung geht meist vom Schaffner selber aus, weil es die größte Chance ist, ein persönliches Verhältnis zum Gast aufzubauen und damit den Wiedererkennungswert, die Sicherung von Zufriedenheit und Spendabilität, zu erhöhen. So gut diese Überbrückungsgespräche über das Urlaubsziel, den Retriever oder die Blasenschwäche des nun auch schon wieder strullenden Ehegatten auch laufen können, entstehen beim Scheitern des Small-Talks unendlich lang erscheinende Sekunden des Schweigens auf der Schneide zwischen meiner Trinkgelderwartung und dem Geiz der Spielverderber. Die hohe Kunst, den Gast von der eigenen intellektuellen Überqualifikation für diese Arbeit zu überzeugen, wird bei Vollendung oft genug entlohnt, deswegen muß ich das Risiko schweigender Penetration immer in Kauf nehmen. Wieder und wieder, zwischen schnellen Bieren und verdrießlichen Snacks, elf Abteile - 25 Gäste lang. Es ist nicht allein Profitgier, die den Schaffner zum Entertainer macht, es ist auch der Wunsch, aus der Routine auszubrechen. Man ist am Arbeitsplatz gefangen, macht auf jeder Fahrt das Gleiche und weiß, daß man einen an sich guten Job erwischt hat. Das kann einen verrückt machen, wenn man sich nicht ein Spielchen sucht. Und abends auf der Hinfahrt ist mein Spiel das Tip-Samen-Sähen. Nach zwei Stunden legt sich der Trubel, alle Betten sind umgeklappt, die Papiere schnell geschrieben. Die erste Zigarette schmeckt wie nach einer opulenten Mahlzeit, ein Schluck aus der Flasche mit dem inzwischen schalen Begrüßungssekt spendet neuen Arbeitsmut. Und meistens kommt gerade in diesem Augenblick einer dieser netten Mittsechziger Ehemänner. „Haben Sie ´nen Klaren ? Ich zahl´den gleich, brauchen Sie nicht auf die Rechnung zu schreiben ! Danke, sagen Sie, fahren Sie bis nach Italien mit ? Ach, und gleich wieder zurück ? Aber Sie haben ja Pause, naja, vier Stunden immerhin. Mein Neffe hat neben dem Studium als Nachtportier gearbeit, der hatte eigentlich den gleichen Job wie Sie, haha. Haben Sie noch einen ? Danke, zahl´ ich wieder sofort, schön kalt das Zeug. Wir fahren schon seit sechzehn Jahren mit diesem Zug, aber Sie sind wirklich der netteste Schaffner. Wissen Sie, meine Frau, die meckert, wenn ich im Urlaub trinke, aber ich fahr ja jetzt noch nicht mit dem Auto. Ihre Freundin ist auch nicht sehr begeistert über die Fahrerei, was? Naja, die Weiber, man kennt sie ja. Was trinken Sie ? Ach so, nicht im Dienst, aber Sie können doch auch ´n bißchen schlafen, kommen Sie, ich geb´ Ihnen einen aus. So, genau, zwei Klare und der Rest ist für Sie !“ Wenn diese Viertelstunde dann überstanden ist, hat man meist schon wieder das Geld eingenommen, das man auf der Fahrt ausgibt. Schaffner - Beruf Nr.62: Barkeeper. Allerdings mit der Besonderheit, daß man den Gast (zusammen mit seiner Frau) am nächsten Morgen wieder sieht. Meine Diskretion lassen sich diese meine Lieblingsgäste oft einiges kosten, als Gegenleistung gebe ich meinem Kunden das Gefühl, er sei der Einzige, mit dem ich solch ein „Privatgespräch“ überhaupt führen würde. Jetzt kann ich zufrieden die Frühstücke für den nächsten Morgen vorbereiten, mit den Kollegen quatschen, etwas Musik hören und mich für ein paar Stunden auf die Pritsche legen. Die Pritsche, so nennen Schaffner, die sich gerne der Fernfahrerterminologie bedienen, jenes etwa Eins-Vierzig lange Verlängerungsstück zum Schaffnersitz am Ende des Ganges, das zu einer Liege ausgeklappt werden kann, deren größter Fehler die Positionierung vor einer der beiden Waggontoiletten ist. Ich habe ´mal ein Essay über die unterschiedlichen Nebengeräusche des Wasserlassens bei Mann und Frau verfasst, dieses dann aber verloren. Es war sehr treffend formuliert und trug eine gewichtige soziokulturelle Komponente.
Hinfahrt - der Morgen
Es spielt überhaupt keine Rolle, wann ein Schlaf- und Liegewagenzug sein Ziel erreicht, mindestens zwei Abteile sind immer schon um fünf Uhr wach. Sie rütteln am schnarchenden Schaffner, der nach Stunden endlich eine erträgliche Stellung auf der Pritsche gefunden hat, um für eine Stunde einzunicken. „Haha, Sie sind ja eingeschlafen !“, wie vom Triumph eines Lehrers, der einen Abschreiber erwischt hat, ermuntert, kommt der Vorschlag zur Wiedergutmachung prompt : „Können wir schon Kaffee haben ?“ Am Morgen hat der Job wenig von Schauspielerei, höchstens man versetzt sich in die Rolle einer gestreßten Bedienung in einem überfüllten Straßencafé an der Piazza Navona. Jeder Gast kriegt ein Frühstück samt durchaus erträglichem Kaffee, Tee oder Kakao. Frische Brötchen nahm der Zug Nachts auf den Weg an die Rivieraküste mit. Jetzt bleibt nicht viel Zeit zur Gipfelschau in den vorbeirasenden Südalpen, denn auch wenn wir unser Ziel erst am Mittag erreichen, werden alle Gäste zwischen Acht und Neun Uhr ihre Sitze wiederhaben und ihr Frühstück vorgesetzt bekommen wollen. Wenn die Körbchen Teller und Tassen fertig sind, kann die nervliche Leistungsshow beginnen. „Hallo !“, tönt es aus der 32. „Haben Sie noch ein bißchen Kaffee ?“ Die gierigen Blicke des älteren Ehepaars aus dem Nebenabteil verheißen ebenfalls nicht Gutes. „Denken Sie noch an uns ?“ Was, die hatten doch schon ihre ersten Tassen ? Meine Argumentation muß sitzen. „Wissen Sie, das ist wie zu Kriegszeiten, erst kriegt jeder einmal und dann gibt´s den Nachschlag.“ „Ja“, antwortet der tatsächlich kriegserprobte Gast eingeschüchtert, „ich wollte ja nur noch einmal nachfragen !“ Typisch, erst brauchen sie ´ne halbe Stunde, um wach zu werdenund dann können sie sich keine fünf Minuten gedulden. Und dann dieser freche Bengel, von 15 Stunden Fahrzeit Drei Stunden auf dem Gang toben, brüllen, stören- scheiß antiautoritäre Erziehung. „Läßt Du mich ´mal vorbei ?“ „Kevin, mein Schatz, läßt Du den Onkel mal vorbei ?“ Vielen Dank, inzwischen bin ich längst in der 51, um die Betten einzuklappen. Fließt der Schweiß, gilt es, die optische Gunst der Stunde zu nutzen. „Haben Sie gut geschlafen ?“; vorgetäuschte Anteilnahme als trinkgeldfördernde Maßnahme, die Antwort als unvermeidliche Konsequenz. „Ach, an und für sich ist es schon sehr ungewohnt, also im ICC schläft man besser !“ „Was Sie nicht sagen - ich wußte gar nicht, daß der ICE nachts fährt ?“ „Doch, der ICC fährt nachts.“ Eine Tür weiter die nächste Grausamkeit: „So, jetzt dürfen Sie auch bei uns die Betten machen und das Frühstück bringen. Sind wir eigentlich pünktliche ?“ „Nein, wir haben drei Minuten Verspätung !“ „Oh, aber das ist doch nicht so dramatisch ?“
... link
Medienfake-Geschichte
herr denes, 01:39Uhr
Fälschungen, Fakes gehören seit seinen Anfangstagen zum Journalismus. Einen relativ umfangreichen Überblick über die Geschichte der Erfindungen in redaktionellen Beiträgen gibt der entsprechende Abschnitt aus der Magisterarbeit von Benjamin Denes. Die im Aufsatz gemachten Literaturangaben mailt Ihnen der Autor gerne auf Anfrage zu.
Eine kurze Kulturgeschichte der journalistischen Fälschung
"Nachrichtenfälscher sind am Werk, seitdem es die Presse gibt", schreibt Haller (2000a: 68), auch weil es früher für die Rezipienten noch schwerer war Fakes als solche auszumachen. Zu den prominenten Produzenten des frühen fiktionalen Journalismus zählten Edgar Allen Poe, der in einem im Jahre 1844 in der New York Sun erschienenen Artikel die erste Atlantiküberquerung in einem Heißluftballon um 134 Jahre vorwegnahm (Ulfkotte 2001: 11) und Mark Twain, der sich wie Poe vor seiner schriftstellerischen Karriere als Journalist bemühte. Er griff die Legende von einem versteinerten Mann auf und narrte damit 1861 die Leser der Territorial Enterprise in Virginia (Ulfkotte 2001: 13). Auch am Anfang des 20.Jahrhunderts gab es Fälscher, wie den Reporter Ben Hecht, der das Chicago Daily Journal mit Schlagzeilen versorgte, "(…)die die Konkurrenz erblassen ließen. ‚Erdbeben zerreißt Chicago' stand in riesigen Lettern über einem vier Spalten breiten Photo der großen Kluft, die das Beben in den Lincoln Parc Beach gerissen haben sollte. Ganze zwei Stunden hatten Hecht und sein Photograph im Sand gegraben, um ein möglichst überzeugendes Photo zu schießen." (Mayer 1998: 84)
In Deutschland gilt als eines der ersten Fakes die von der Hamburger Zeitschrift Minerva zwischen 1797 und 1799 lancierte Legende der sogenannten "Potemkinschen Dörfer" (Ulfkotte 2001: 74). Als eine frühe Form des freien Mitarbeiters betätigte sich Arthur Schütz, der Erfinder des "Grubenhundes" (vgl. Mayer 1998: 23f.), in dem er der Wiener Neuen Freien Presse wiederholt erfundene Meldungen zukommen ließ. "Sein stärkstes Stück erschien am 18. November 1911 - ein Bericht über ein angebliches Erdbeben im Ostrauer Kohlerevier, in dem es hieß, dass der "im Laboratorium schlafende Grubenhund schon eine halbe Stunde vor Beginn des Bebens auffallende Zeichen größter Unruhe gab." Jeder halbwegs informierte Zeitgenosse hätte wissen müssen, dass in der Bergwerkersprache der "Hund" eine handgezogene Lore bedeutete." (Haller 2000a: 69)
In dieser Zeit setzten sich auch im deutschen Sprachraum mediale Fakes mehr und mehr durch. Erich Kästner, der in seinem Roman "Fabian" auch das Ausschmücken von Zeitungsmeldungen mit erfundenen Tatsachen beschreibt, sagte nach seiner Zeit als angestellter Redakteur: "Meldungen, deren Unwahrheit nicht oder erst nach Wochen festgestellt werden kann, sind wahr" (Kästner zit. nach Mayer 1998: 87).
Ohne im Sinne der in der vorliegenden Untersuchung geltenden Definition ein Fake zu sein, darf in dieser Chronologie nicht die von Orson Wells geschriebene Hörspielfassung "Krieg der Welten" fehlen. Die auf einem Roman von H.G. Wells aufbauende Radiosendung wurde im Oktober 1938 vom Sender CBS von New York aus in die gesamten USA übertragen. Das Hörspiel handelte von der Invasion von Marsmenschen in New Jersey und wurde geschickt in das laufende Programm integriert, es gab Live-Schaltungen, Expertisen und sich permanent verändernde Nachrichten, gewissermaßen im Stile der "Breaking News" von CNN. Unklar ist bis heute, inwieweit die Massenpanik, welche die Ausstrahlung von "Krieg der Welten" im Einzugsgebiet von CBS ausgelöst haben soll, wirklich stattgefunden hat (vgl. Mayer 1998: 131ff.).
Sprunghaft angestiegen ist die Anzahl der enttarnten Elaborate des fiktionalen Journalismus seit Anfang der Siebzigerjahre, über die Gründe wird im nächsten Kapitel zu sprechen sein. Ramonet (1999) sieht die modernen Gesellschaften in der "Kommunikationsfalle" und vermutet die Ursache in einer veränderte Auffassung von Journalismus in den letzten dreißig Jahren: "[V]erschiedene Gründe - technologischer, politischer, wirtschaftlicher und rhetorischer Art - haben mitgewirkt" (Ramonet 1999: 55). Man kann diese Entwicklung am veränderten Realitätsempfinden der Rezipienten messen: "In unserem intellektuellen Umfeld zählt vornehmlich die mediale Wahrheit. Welches ist diese Wahrheit? Wenn Presse, Radio und Fernsehen hinsichtlich eines Ereignisses erklären, etwas sei wahr, dann steht fest, dass es auch wahr ist; selbst wenn es nicht wahr ist. Denn wahr ist fortan das, was die Gesamtheit der Medien für wahr erklärt." (Ramonet 1999: 57)
Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf journalistische Fälschungen, sie schließt auch fiktionale Inhalte ein, die von PR oder Politikern lanciert werden. Dennoch kann auch für den fiktionalen Journalismus gelten, dass seine Elaborate als wahr gelten, solange sie von den Medien (und sei es nur das eine, das Fake veröffentlichende) für wahr erklärt werden. "Fälschungen haben in einer durch und durch öffentlichkeitsorientierten Welt enorme strategische Bedeutung", schreibt Müller-Ullrich (1996: 17), der ebenfalls "politische, wirtschaftliche oder kriminelle Absichten" dahinter vermutet (Müller-Ullrich 1996: 17). Mediale Fakes sind nicht wahr und trotzdem vorstellbar, deswegen können sie für ihre Urheber sehr wertvoll sein: "Heute liegt der Marktwert einer Information in der Anzahl von Personen, die sich für sie interessieren könnten. Diese Zahl hat indes nichts mit der Wahrheit zu tun" (Ramonet 1999: 95).
Mit den Fälschungen nahm auch die Anzahl ihrer Enttarnungen zu. Stellvertretend für die Elaborate jener Fake-Moderne kann die weltweit vermutlich bekannteste journalistische Erfindung als Beispiel dienen: "Jimmy's World" lautete der Titel einer Reportage der jungen Redakteurin Janet Cooke, die im Jahr 1980 bei der Washington Post eingestellt worden war. Sie erhielt im September des gleichen Jahres als einen der ersten Aufträge, dem Gerücht nachzugehen, in einem Krankenhaus der Stadt werde ein achtjähriger Junge behandelt, der heroinabhängig sei (Cooke 1980: Anlage I; vgl. Ulfkotte 2001: 46f.). Cooke suchte vergeblich nach dem Jungen und unterlag dem Reiz, die Geschichte zum Gerücht einfach zu erfinden. Der Erfolg bei den Lesern war beträchtlich und so erhielt sie nicht einmal ein Jahr nach ihrer Anstellung den renommierten Pulitzerpreis. Groß war die Ernüchterung, als sich herausstellte, dass ausgerechnet bei dem Blatt, dass knapp zehn Jahre zuvor die "Watergate-Affäre" aufgedeckt hatte, ein reines Fake erschienen war (vgl. Mayer 1998: 79ff.; Ramonet 1999: 81). Die Fake-Moderne war außerdem von Fälschern wie Christoph Jones, der für die New York Times 1981 erfundene Frontreportagen aus Kambodscha ablieferte (Ramonet 1999: 81) und natürlich von Konrad Kujau und Gerd Heidemann geprägt.
Das bislang bekannteste deutsche Fake und international ebenfalls stark beachtet sind fraglos die sogenannten "Hitler-Tagebücher". Was der stern-Redakteur Heidemann aus einer Idee des Kunstfälschers Kujau gemacht hatte, sollte später sogar den Stoff für den erfolgreichen Kinofilm "Stonk!" liefern und war für die deutsche Presselandschaft ein "Supergau" (Haller 2000a: 68). Am 28. April 1983 erschien der stern mit dem Titel "Hitlers Tagebücher entdeckt". Eben diese hatten Gerd Heidemann und Konrad Kujau gefälscht, insgesamt hatte das Magazin knapp 10 Millionen Mark für das Fake bezahlt. Kujau und Heidemann kamen ins Gefängnis (siehe auch Abschnitt 5.3), die damaligen Chefredakteure Koch und Schmidt mussten ihren Hut nehmen (Ulfkotte 2001: 50f.; Mayer 1998: 151ff.). In der Folgezeit kam es zu Diskussionen über die Mitverantwortung des Journalisten Heidemann an der von Kujau initiierten Fälschung, bei der nicht nur die stern-Redaktion versuchte, das Medienunternehmen und seine(n) Angestellten in der Opferrolle zu präsentieren (vgl. Ulfkotte 2001: 50ff.; Müller-Ullrich 1996: 195). Die "Hitler-Tagebücher", das wird unter anderem das vierte Kapitel dieser Arbeit zeigen, sind jedoch ganz gewiss eine Fälschung im Journalismus, auch wenn bei ihnen der Journalist "nur" als Partner aufgetreten ist. [top]
Zwei weitere Fälscher erregten in Deutschland danach die landesweite Aufmerksamkeit: Zunächst der für Boulevardmagazine wie stern TV arbeitende Filmemacher Michael Born. "In der Zeit von 1990 bis 1995 produzierte und verkaufte Born insgesamt 21 teilweise oder völlig gefälschte TV-Beiträge an die ARD, das ZDF, das Schweizer Fernsehen DRS, SAT 1, RTL, PRO 7 und VOX" (Morgenthaler 2000: 73). Unter den bekanntesten seiner Fakes waren der Beitrag über die vermeintlichen Untriebe des Ku-Klux-Klan in der Eifel (1994), die Reportage über deutsche Katzenjäger (1995) und der Filmbericht über einen von einem Krötensekret abhängigen Junkie (1994) (vgl. u.a. Born 1997: 111-166). Die teilweise äußerst liebevoll angefertigten Film-Fakes brachten ihren Macher ins Gefängnis, weil die Verantwortlichen von stern TV, um nicht selbst verfolgt zu werden, ihn angezeigt hatten. Born veröffentlichte ein Buch über seine Geschichte(n) und begann offensiv mit dem Thema umzugehen. Er wies auf das Mitwissen der gesamten Redaktion von stern TV (inklusive des Moderators Günther Jauch) hin, richtete eine Website ein, von der aus bis heute Videozusammenschnitte der "besten Fakes" verkauft werden.
Im Jahr 2000 wurde Tom Kummer, ein Mitarbeiter des Magazins der Süddeutschen Zeitung, beim Faken erwischt. Er hatte mehrere Interviews mit Prominenten gefälscht, hatte sich einzelne Passagen ausgedacht und andere aus Biographien und älteren Interviews zusammengeklaut. Im Nachhinein (also auf die Enttarnung folgend) unternahm Kummer den Versuch, seine Artikel "als Konzeptkunst zu verkaufen" (Franzetti 2000: 49). Er führte den Begriff des "Borderline-Journalismus" ein (Wolf 2000: 34) und merkte nicht ganz zu Unrecht an, dass Journalisten bei den meisten Interviews die überlangen, nicht wohlgeformten oder fremdsprachigen Antworten ihrer Gesprächspartner verändern würden (vgl. u.a. Ernst 2000). Kummer und auch die damaligen Chefredakteure des SZ-Magazin kostete sein Grenzgängertum zwischen Wirklichkeit und Fiktion den Job.
In den USA gab es in den letzten zehn Jahren eine Reihe weiterer prominenter Fälle des fiktionalen Journalismus, die enttarnt wurden. Stephen Glass, der unter anderem für das New York Times-Magazin und The New Republic fakte, die Kolumnisten Mike Barnicle und Patricia Smith, die vom Boston Globe wegen "news fabricating" entlassen wurden und zuletzt Michael Finkel, den das Magazin der New York Times für das Zusammenführen von mehreren Einzelschicksalen zu einem fiktiven Reportagehelden entließ. Einige der Fälschungen dieser Autoren werden im Rahmen der Typologie journalistischer Fälschungen vorgestellt werden (Kapitel 4).
In einem geschichtlichen Überblick der medialen Fakes muss auch auf die Häufung derselben zu Kriegs- bzw. Krisenzeiten hingewiesen werden. Ramonet (1999) weist auf einige dieser Fälschungen hin, zu denen im Rahmen des Aufstandes in Rumänien die Inszenierung eines Massengrabes in Timisoara zählte. "Die auf weißen Leintüchern aufgereihten Leichen waren nicht die Opfer des Massakers vom 17. Dezember 1989, sondern vielmehr Tote, die man auf dem Armenfriedhof ausgegraben hatte (...)" (Ramonet 1999: 128). Wer die Fälschung initiiert hatte, ist bis heute unklar, fest steht lediglich, dass die Bilder von angeblich 60.000- 70.000 Leichen auf Fernsehkanälen rund um den Globus zu sehen waren, darunter auch ARD, ZDF und RTLplus. Das "Massaker von Timisoara" forderte, wie sich später herausstellte, jedoch "nur" einige Dutzend Todesopfer, in ganz Rumänien waren es 689 (Müller-Ullrich 1996: 145ff.). Im Golfkrieg betätigten sich vor allem die amerikanischen Medien als Mythenmacher, so institutionalisierten sie Symbole wie die Patriot-Rakete, die Gasmaske oder den Tarnkappenbomber als eine Art Füllfake, weil die "echten Kriegsbilder" fehlten (vgl. Ramonet 1999: 139ff). Diese Form der Propaganda gehört nicht zum Kern des Themas, weil derartige Manipulationen in der Regel eher von Militärs und Politikern lanciert werden, dennoch soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass mit dem wachsenden Engagement der Bundeswehr auch in deutschen Medien die Legitimationsfakes zugenommen haben. Die ARD-Dokumentation "Es begann mit einer Lüge" enthüllte beispielsweise reihenweise Fälschungen deutscher Medien im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg und dem Massaker von Pristina (ARD, 8. Februar 2001).
Die Diskussion über Fiktionalität in der medialen Berichterstattung ist in den jüngeren Vergangenheit auch von einer Reihe von (Pseudo-)Events angeregt worden, die keine reinen Fakes und teilweise auch keine Belege für Faction waren und dennoch die Aufmerksamkeit auf das Thema lenkten. Der tragische Tod von Lady Di führte zu einem medialen "Kurzschlusseffekt (...), bei dem eine Figur aus einem Fortsetzungsroman oder einer Telenovela plötzlich zum Status einer Persönlichkeit aufsteigt, die der Qualitätspresse für würdig befunden wird" (Ramonet 1999: 15). Der von einem Paparazzi und der Yellowpress mitverschuldete Autounfall sorgte für eine Art institutionalisierter Entrüstung, vor allem freute sich das globale Nachrichten-Netzwerk über den ersten Informations-Megaevent, einen Fall "emotioneller Globalisierung" (Ramonet 1999: 15). Schon zuvor war eine fiktionale Blaupause von Dianas Persönlichkeit zum Gegenstand der Berichterstattung geworden, die zur tragischen Heldin gemacht werden sollte.
Zur Gattung der Gerüchte, von denen gerade die zuletzt genannten Mediengattungen gut leben, gehören auch die "self-fulfilling-prophecies". In Deutschland kann man wohl im Zusammenhang mit dem "Fall Joseph" von einer solchen sprechen. Die Bild hatte die Geschichte einer verzweifelten Mutter übernommen, die aus dem Badeunfall ihres kleinen Sohnes die heimtückische Straftat von Neonazis machte. Wenngleich dieser Fall, zumindest in der originären Berichterstattung nicht in den definierten Untersuchungsgegenstand gehört, (weil die Urheberin des Fakes keine Journalistin ist), werden am Beispiel Sebnitz alle Qualitäten deutlich, die fiktionaler Journalismus, hier die Spielart Faction, haben muss. Die Story muss nicht unbedingt wahr sein, sondern in einer Welt x nur vorstellbar. "Wir brauchen kontinuierliche Berichterstattung, wir brauchen Hintergrund. Dann gab es, das muss man auch positiv sehen, bei der Bild-Zeitung die Tendenz, sich ganz kritisch und intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen. Das war ja auch nicht immer so. Und dann kommt diese wunderbare Story auf den Tisch. Die ist wie gemalt. Alles passt zusammen: Da ist dieser kleine Junge, die bringen den um, und am Beckenrand stehen 200 Bürger und klatschen Beifall. Das haben wir ja alle vor Augen gesehen. Und das war, um es zynisch zu sagen, viel zu schön, um wahr zu sein." (Weischenberg 2000: 47)
Das Schlimme am Fall Sebnitz ist vor allem die Tatsache, dass die rechtsextremen Kreise in Deutschland dadurch das Thema fiktionaler Journalismus aufs Neue für sich entdeckt haben und in Büchern und Zeitungsartikeln die Presse anprangerten.
Nicht zu vergessen sind schließlich die allzu oft von Fotomontagen illustrierten Gerüchte der Yellowpress über Prominente und vermeintlich Prominente. Es ist durchaus legitim, für eine Untersuchung medialer Fakes die diversen Gerichtsentscheidungen auf Unterlassung, Gegendarstellung oder gar Schmerzensgeld heranzuziehen (siehe auch 5.3). Ein Beispiel aus diesem Feld der medialen Fakes hat dabei wegen der Maßstäbe setzenden Prozesswelle besondere Beachtung erwähnt, nämlich die Berichterstattung über das Liebesleben von Caroline von Monaco (vgl. u.a. Ramonet 1999: 91). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mediale Fakes mit einiger Sicherheit so alt sein dürften wie der Journalismus selbst. Bemerkenswert ist die Anhäufung der enttarnten Fälle in den vergangenen 20 Jahren, die auch eine Zunahme der Fälschungen nahe legt. Die Determinanten für mediale Fakes sollen im kommenden Kapitel daher näher betrachtet werden, genauso ihre kommunikative und gesellschaftliche Wirkung.
Eine kurze Kulturgeschichte der journalistischen Fälschung
"Nachrichtenfälscher sind am Werk, seitdem es die Presse gibt", schreibt Haller (2000a: 68), auch weil es früher für die Rezipienten noch schwerer war Fakes als solche auszumachen. Zu den prominenten Produzenten des frühen fiktionalen Journalismus zählten Edgar Allen Poe, der in einem im Jahre 1844 in der New York Sun erschienenen Artikel die erste Atlantiküberquerung in einem Heißluftballon um 134 Jahre vorwegnahm (Ulfkotte 2001: 11) und Mark Twain, der sich wie Poe vor seiner schriftstellerischen Karriere als Journalist bemühte. Er griff die Legende von einem versteinerten Mann auf und narrte damit 1861 die Leser der Territorial Enterprise in Virginia (Ulfkotte 2001: 13). Auch am Anfang des 20.Jahrhunderts gab es Fälscher, wie den Reporter Ben Hecht, der das Chicago Daily Journal mit Schlagzeilen versorgte, "(…)die die Konkurrenz erblassen ließen. ‚Erdbeben zerreißt Chicago' stand in riesigen Lettern über einem vier Spalten breiten Photo der großen Kluft, die das Beben in den Lincoln Parc Beach gerissen haben sollte. Ganze zwei Stunden hatten Hecht und sein Photograph im Sand gegraben, um ein möglichst überzeugendes Photo zu schießen." (Mayer 1998: 84)
In Deutschland gilt als eines der ersten Fakes die von der Hamburger Zeitschrift Minerva zwischen 1797 und 1799 lancierte Legende der sogenannten "Potemkinschen Dörfer" (Ulfkotte 2001: 74). Als eine frühe Form des freien Mitarbeiters betätigte sich Arthur Schütz, der Erfinder des "Grubenhundes" (vgl. Mayer 1998: 23f.), in dem er der Wiener Neuen Freien Presse wiederholt erfundene Meldungen zukommen ließ. "Sein stärkstes Stück erschien am 18. November 1911 - ein Bericht über ein angebliches Erdbeben im Ostrauer Kohlerevier, in dem es hieß, dass der "im Laboratorium schlafende Grubenhund schon eine halbe Stunde vor Beginn des Bebens auffallende Zeichen größter Unruhe gab." Jeder halbwegs informierte Zeitgenosse hätte wissen müssen, dass in der Bergwerkersprache der "Hund" eine handgezogene Lore bedeutete." (Haller 2000a: 69)
In dieser Zeit setzten sich auch im deutschen Sprachraum mediale Fakes mehr und mehr durch. Erich Kästner, der in seinem Roman "Fabian" auch das Ausschmücken von Zeitungsmeldungen mit erfundenen Tatsachen beschreibt, sagte nach seiner Zeit als angestellter Redakteur: "Meldungen, deren Unwahrheit nicht oder erst nach Wochen festgestellt werden kann, sind wahr" (Kästner zit. nach Mayer 1998: 87).
Ohne im Sinne der in der vorliegenden Untersuchung geltenden Definition ein Fake zu sein, darf in dieser Chronologie nicht die von Orson Wells geschriebene Hörspielfassung "Krieg der Welten" fehlen. Die auf einem Roman von H.G. Wells aufbauende Radiosendung wurde im Oktober 1938 vom Sender CBS von New York aus in die gesamten USA übertragen. Das Hörspiel handelte von der Invasion von Marsmenschen in New Jersey und wurde geschickt in das laufende Programm integriert, es gab Live-Schaltungen, Expertisen und sich permanent verändernde Nachrichten, gewissermaßen im Stile der "Breaking News" von CNN. Unklar ist bis heute, inwieweit die Massenpanik, welche die Ausstrahlung von "Krieg der Welten" im Einzugsgebiet von CBS ausgelöst haben soll, wirklich stattgefunden hat (vgl. Mayer 1998: 131ff.).
Sprunghaft angestiegen ist die Anzahl der enttarnten Elaborate des fiktionalen Journalismus seit Anfang der Siebzigerjahre, über die Gründe wird im nächsten Kapitel zu sprechen sein. Ramonet (1999) sieht die modernen Gesellschaften in der "Kommunikationsfalle" und vermutet die Ursache in einer veränderte Auffassung von Journalismus in den letzten dreißig Jahren: "[V]erschiedene Gründe - technologischer, politischer, wirtschaftlicher und rhetorischer Art - haben mitgewirkt" (Ramonet 1999: 55). Man kann diese Entwicklung am veränderten Realitätsempfinden der Rezipienten messen: "In unserem intellektuellen Umfeld zählt vornehmlich die mediale Wahrheit. Welches ist diese Wahrheit? Wenn Presse, Radio und Fernsehen hinsichtlich eines Ereignisses erklären, etwas sei wahr, dann steht fest, dass es auch wahr ist; selbst wenn es nicht wahr ist. Denn wahr ist fortan das, was die Gesamtheit der Medien für wahr erklärt." (Ramonet 1999: 57)
Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf journalistische Fälschungen, sie schließt auch fiktionale Inhalte ein, die von PR oder Politikern lanciert werden. Dennoch kann auch für den fiktionalen Journalismus gelten, dass seine Elaborate als wahr gelten, solange sie von den Medien (und sei es nur das eine, das Fake veröffentlichende) für wahr erklärt werden. "Fälschungen haben in einer durch und durch öffentlichkeitsorientierten Welt enorme strategische Bedeutung", schreibt Müller-Ullrich (1996: 17), der ebenfalls "politische, wirtschaftliche oder kriminelle Absichten" dahinter vermutet (Müller-Ullrich 1996: 17). Mediale Fakes sind nicht wahr und trotzdem vorstellbar, deswegen können sie für ihre Urheber sehr wertvoll sein: "Heute liegt der Marktwert einer Information in der Anzahl von Personen, die sich für sie interessieren könnten. Diese Zahl hat indes nichts mit der Wahrheit zu tun" (Ramonet 1999: 95).
Mit den Fälschungen nahm auch die Anzahl ihrer Enttarnungen zu. Stellvertretend für die Elaborate jener Fake-Moderne kann die weltweit vermutlich bekannteste journalistische Erfindung als Beispiel dienen: "Jimmy's World" lautete der Titel einer Reportage der jungen Redakteurin Janet Cooke, die im Jahr 1980 bei der Washington Post eingestellt worden war. Sie erhielt im September des gleichen Jahres als einen der ersten Aufträge, dem Gerücht nachzugehen, in einem Krankenhaus der Stadt werde ein achtjähriger Junge behandelt, der heroinabhängig sei (Cooke 1980: Anlage I; vgl. Ulfkotte 2001: 46f.). Cooke suchte vergeblich nach dem Jungen und unterlag dem Reiz, die Geschichte zum Gerücht einfach zu erfinden. Der Erfolg bei den Lesern war beträchtlich und so erhielt sie nicht einmal ein Jahr nach ihrer Anstellung den renommierten Pulitzerpreis. Groß war die Ernüchterung, als sich herausstellte, dass ausgerechnet bei dem Blatt, dass knapp zehn Jahre zuvor die "Watergate-Affäre" aufgedeckt hatte, ein reines Fake erschienen war (vgl. Mayer 1998: 79ff.; Ramonet 1999: 81). Die Fake-Moderne war außerdem von Fälschern wie Christoph Jones, der für die New York Times 1981 erfundene Frontreportagen aus Kambodscha ablieferte (Ramonet 1999: 81) und natürlich von Konrad Kujau und Gerd Heidemann geprägt.
Das bislang bekannteste deutsche Fake und international ebenfalls stark beachtet sind fraglos die sogenannten "Hitler-Tagebücher". Was der stern-Redakteur Heidemann aus einer Idee des Kunstfälschers Kujau gemacht hatte, sollte später sogar den Stoff für den erfolgreichen Kinofilm "Stonk!" liefern und war für die deutsche Presselandschaft ein "Supergau" (Haller 2000a: 68). Am 28. April 1983 erschien der stern mit dem Titel "Hitlers Tagebücher entdeckt". Eben diese hatten Gerd Heidemann und Konrad Kujau gefälscht, insgesamt hatte das Magazin knapp 10 Millionen Mark für das Fake bezahlt. Kujau und Heidemann kamen ins Gefängnis (siehe auch Abschnitt 5.3), die damaligen Chefredakteure Koch und Schmidt mussten ihren Hut nehmen (Ulfkotte 2001: 50f.; Mayer 1998: 151ff.). In der Folgezeit kam es zu Diskussionen über die Mitverantwortung des Journalisten Heidemann an der von Kujau initiierten Fälschung, bei der nicht nur die stern-Redaktion versuchte, das Medienunternehmen und seine(n) Angestellten in der Opferrolle zu präsentieren (vgl. Ulfkotte 2001: 50ff.; Müller-Ullrich 1996: 195). Die "Hitler-Tagebücher", das wird unter anderem das vierte Kapitel dieser Arbeit zeigen, sind jedoch ganz gewiss eine Fälschung im Journalismus, auch wenn bei ihnen der Journalist "nur" als Partner aufgetreten ist. [top]
Zwei weitere Fälscher erregten in Deutschland danach die landesweite Aufmerksamkeit: Zunächst der für Boulevardmagazine wie stern TV arbeitende Filmemacher Michael Born. "In der Zeit von 1990 bis 1995 produzierte und verkaufte Born insgesamt 21 teilweise oder völlig gefälschte TV-Beiträge an die ARD, das ZDF, das Schweizer Fernsehen DRS, SAT 1, RTL, PRO 7 und VOX" (Morgenthaler 2000: 73). Unter den bekanntesten seiner Fakes waren der Beitrag über die vermeintlichen Untriebe des Ku-Klux-Klan in der Eifel (1994), die Reportage über deutsche Katzenjäger (1995) und der Filmbericht über einen von einem Krötensekret abhängigen Junkie (1994) (vgl. u.a. Born 1997: 111-166). Die teilweise äußerst liebevoll angefertigten Film-Fakes brachten ihren Macher ins Gefängnis, weil die Verantwortlichen von stern TV, um nicht selbst verfolgt zu werden, ihn angezeigt hatten. Born veröffentlichte ein Buch über seine Geschichte(n) und begann offensiv mit dem Thema umzugehen. Er wies auf das Mitwissen der gesamten Redaktion von stern TV (inklusive des Moderators Günther Jauch) hin, richtete eine Website ein, von der aus bis heute Videozusammenschnitte der "besten Fakes" verkauft werden.
Im Jahr 2000 wurde Tom Kummer, ein Mitarbeiter des Magazins der Süddeutschen Zeitung, beim Faken erwischt. Er hatte mehrere Interviews mit Prominenten gefälscht, hatte sich einzelne Passagen ausgedacht und andere aus Biographien und älteren Interviews zusammengeklaut. Im Nachhinein (also auf die Enttarnung folgend) unternahm Kummer den Versuch, seine Artikel "als Konzeptkunst zu verkaufen" (Franzetti 2000: 49). Er führte den Begriff des "Borderline-Journalismus" ein (Wolf 2000: 34) und merkte nicht ganz zu Unrecht an, dass Journalisten bei den meisten Interviews die überlangen, nicht wohlgeformten oder fremdsprachigen Antworten ihrer Gesprächspartner verändern würden (vgl. u.a. Ernst 2000). Kummer und auch die damaligen Chefredakteure des SZ-Magazin kostete sein Grenzgängertum zwischen Wirklichkeit und Fiktion den Job.
In den USA gab es in den letzten zehn Jahren eine Reihe weiterer prominenter Fälle des fiktionalen Journalismus, die enttarnt wurden. Stephen Glass, der unter anderem für das New York Times-Magazin und The New Republic fakte, die Kolumnisten Mike Barnicle und Patricia Smith, die vom Boston Globe wegen "news fabricating" entlassen wurden und zuletzt Michael Finkel, den das Magazin der New York Times für das Zusammenführen von mehreren Einzelschicksalen zu einem fiktiven Reportagehelden entließ. Einige der Fälschungen dieser Autoren werden im Rahmen der Typologie journalistischer Fälschungen vorgestellt werden (Kapitel 4).
In einem geschichtlichen Überblick der medialen Fakes muss auch auf die Häufung derselben zu Kriegs- bzw. Krisenzeiten hingewiesen werden. Ramonet (1999) weist auf einige dieser Fälschungen hin, zu denen im Rahmen des Aufstandes in Rumänien die Inszenierung eines Massengrabes in Timisoara zählte. "Die auf weißen Leintüchern aufgereihten Leichen waren nicht die Opfer des Massakers vom 17. Dezember 1989, sondern vielmehr Tote, die man auf dem Armenfriedhof ausgegraben hatte (...)" (Ramonet 1999: 128). Wer die Fälschung initiiert hatte, ist bis heute unklar, fest steht lediglich, dass die Bilder von angeblich 60.000- 70.000 Leichen auf Fernsehkanälen rund um den Globus zu sehen waren, darunter auch ARD, ZDF und RTLplus. Das "Massaker von Timisoara" forderte, wie sich später herausstellte, jedoch "nur" einige Dutzend Todesopfer, in ganz Rumänien waren es 689 (Müller-Ullrich 1996: 145ff.). Im Golfkrieg betätigten sich vor allem die amerikanischen Medien als Mythenmacher, so institutionalisierten sie Symbole wie die Patriot-Rakete, die Gasmaske oder den Tarnkappenbomber als eine Art Füllfake, weil die "echten Kriegsbilder" fehlten (vgl. Ramonet 1999: 139ff). Diese Form der Propaganda gehört nicht zum Kern des Themas, weil derartige Manipulationen in der Regel eher von Militärs und Politikern lanciert werden, dennoch soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass mit dem wachsenden Engagement der Bundeswehr auch in deutschen Medien die Legitimationsfakes zugenommen haben. Die ARD-Dokumentation "Es begann mit einer Lüge" enthüllte beispielsweise reihenweise Fälschungen deutscher Medien im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg und dem Massaker von Pristina (ARD, 8. Februar 2001).
Die Diskussion über Fiktionalität in der medialen Berichterstattung ist in den jüngeren Vergangenheit auch von einer Reihe von (Pseudo-)Events angeregt worden, die keine reinen Fakes und teilweise auch keine Belege für Faction waren und dennoch die Aufmerksamkeit auf das Thema lenkten. Der tragische Tod von Lady Di führte zu einem medialen "Kurzschlusseffekt (...), bei dem eine Figur aus einem Fortsetzungsroman oder einer Telenovela plötzlich zum Status einer Persönlichkeit aufsteigt, die der Qualitätspresse für würdig befunden wird" (Ramonet 1999: 15). Der von einem Paparazzi und der Yellowpress mitverschuldete Autounfall sorgte für eine Art institutionalisierter Entrüstung, vor allem freute sich das globale Nachrichten-Netzwerk über den ersten Informations-Megaevent, einen Fall "emotioneller Globalisierung" (Ramonet 1999: 15). Schon zuvor war eine fiktionale Blaupause von Dianas Persönlichkeit zum Gegenstand der Berichterstattung geworden, die zur tragischen Heldin gemacht werden sollte.
Zur Gattung der Gerüchte, von denen gerade die zuletzt genannten Mediengattungen gut leben, gehören auch die "self-fulfilling-prophecies". In Deutschland kann man wohl im Zusammenhang mit dem "Fall Joseph" von einer solchen sprechen. Die Bild hatte die Geschichte einer verzweifelten Mutter übernommen, die aus dem Badeunfall ihres kleinen Sohnes die heimtückische Straftat von Neonazis machte. Wenngleich dieser Fall, zumindest in der originären Berichterstattung nicht in den definierten Untersuchungsgegenstand gehört, (weil die Urheberin des Fakes keine Journalistin ist), werden am Beispiel Sebnitz alle Qualitäten deutlich, die fiktionaler Journalismus, hier die Spielart Faction, haben muss. Die Story muss nicht unbedingt wahr sein, sondern in einer Welt x nur vorstellbar. "Wir brauchen kontinuierliche Berichterstattung, wir brauchen Hintergrund. Dann gab es, das muss man auch positiv sehen, bei der Bild-Zeitung die Tendenz, sich ganz kritisch und intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen. Das war ja auch nicht immer so. Und dann kommt diese wunderbare Story auf den Tisch. Die ist wie gemalt. Alles passt zusammen: Da ist dieser kleine Junge, die bringen den um, und am Beckenrand stehen 200 Bürger und klatschen Beifall. Das haben wir ja alle vor Augen gesehen. Und das war, um es zynisch zu sagen, viel zu schön, um wahr zu sein." (Weischenberg 2000: 47)
Das Schlimme am Fall Sebnitz ist vor allem die Tatsache, dass die rechtsextremen Kreise in Deutschland dadurch das Thema fiktionaler Journalismus aufs Neue für sich entdeckt haben und in Büchern und Zeitungsartikeln die Presse anprangerten.
Nicht zu vergessen sind schließlich die allzu oft von Fotomontagen illustrierten Gerüchte der Yellowpress über Prominente und vermeintlich Prominente. Es ist durchaus legitim, für eine Untersuchung medialer Fakes die diversen Gerichtsentscheidungen auf Unterlassung, Gegendarstellung oder gar Schmerzensgeld heranzuziehen (siehe auch 5.3). Ein Beispiel aus diesem Feld der medialen Fakes hat dabei wegen der Maßstäbe setzenden Prozesswelle besondere Beachtung erwähnt, nämlich die Berichterstattung über das Liebesleben von Caroline von Monaco (vgl. u.a. Ramonet 1999: 91). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mediale Fakes mit einiger Sicherheit so alt sein dürften wie der Journalismus selbst. Bemerkenswert ist die Anhäufung der enttarnten Fälle in den vergangenen 20 Jahren, die auch eine Zunahme der Fälschungen nahe legt. Die Determinanten für mediale Fakes sollen im kommenden Kapitel daher näher betrachtet werden, genauso ihre kommunikative und gesellschaftliche Wirkung.
... link
Vita
herr denes, 01:32Uhr
Benjamin Denes, M.A.

Name: Benjamin Denes
Geboren: 22.Juli 1975 in Berlin.
Volontariat: Oktober 2003 bis März 2005 an der ems Babelsberg, ELECTRONIC MEDIA SCHOOL/SCHULE FÜR ELEKTRONISCHE MEDIEN.
Schulabschluss: Juli 1994: Abitur.
Zivildienst: August 1994 bis September 1995: Altenpfleger.
Studium:
M.A. der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und der Germ. Linguistik (November 2003)
Sommer 1996 bis Sommer 2003: Publizistik an der FU Berlin,
Winter 1995/96 bis Sommer 2003: Germ. Linguistik an der HU und der FU Berlin,
Winter 1995/96 bis Sommer 1996: Italienisch an der HU Berlin
Schwerpunkte: Mediensysteme und Kommunikationskulturen (Publizistik), Psycholinguistik.
Magisterarbeit: "Fälschungen im Journalismus. Determinanten und Formen von Erfindungen in redaktionellen Beiträgen."
Gutachter: Prof. Dr. Manfred Buchwald.
Studienfinanzierung:
Nachtzüge:
November 1995 bis August 1998: Schlaf- und Liegewagenbetreuer bei der Compagnie Int. de Wagons-Lits,
seit Juli 1999 bis 2003: Zugreiseleiter bei der RBG und der DB EuropeanRailservice.
Information:
September 1998 bis Juni 1999: Infostellenmitarbeiter bei der Berlin Tourismus Marketing.
Journalistische Jobs:
Radio:
November 1994 bis Mai 1995: 25 Moderationen beim Offenen Kanal Berlin;
Februar/März 1997: Praktikum bei JAM FM;
April 1997 bis Juli 1997: Redakteur und Moderator bei JAM FM .
Januar 2004 bis März 2004: Volontariatspraktikum in der RBB Sportredaktion (infoRADIO).
Fernsehen:
Mai 2004 bis Juli 2004: Volontariatspraktikum bei XXP (Spiegel TV Berlin).
Print:
März 1998 bis Mai 1999: Freier Autor für das "iq"-Magazin,Ressorts Gesellschaft, Musik, Sport;
März 2002: 2 Beiträge für Nullnummern des Wirtschaftsmagazins "Faktor" (keine Veröffentlichung - nur zur Werbeaquise);
seit Mai 2003: Kolumnist des t5-Journals, Rheinlad-Pfalz.
Online:
Seit September 1999: Autor beim "evolver" (Wien), evolver.at.
Fähigkeiten/ Interessen
Sprachen: Englisch, Italienisch, großes Latinum, kleines Graecum. (Durch die Arbeit im AutoZug International Konversationskenntnisse des Französischen und Niederländischen.) Journalismus: Hörfunkbeiträge mit digitalem Schnittplatzsystem produzieren, Selbstfahrerstudio. EDV: MS-Office, Photoshop, Dreamweaver. Bahn: Zugschaffner im Bahnbetriebsdienst.Qualifikation für ICE-Schnellfahrstrecken, Selbstrettungskonzept. Notfallausbildung durch DB Netz. Interessen: Medienfakes, Krisenkommunikation, Katastrophenanalyse im professionellen Sektor, Rockmusik, Fatalismus-Literatur, italienischer Fußball im privaten Sektor.

Name: Benjamin Denes
Geboren: 22.Juli 1975 in Berlin.
Volontariat: Oktober 2003 bis März 2005 an der ems Babelsberg, ELECTRONIC MEDIA SCHOOL/SCHULE FÜR ELEKTRONISCHE MEDIEN.
Schulabschluss: Juli 1994: Abitur.
Zivildienst: August 1994 bis September 1995: Altenpfleger.
Studium:
M.A. der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und der Germ. Linguistik (November 2003)
Sommer 1996 bis Sommer 2003: Publizistik an der FU Berlin,
Winter 1995/96 bis Sommer 2003: Germ. Linguistik an der HU und der FU Berlin,
Winter 1995/96 bis Sommer 1996: Italienisch an der HU Berlin
Schwerpunkte: Mediensysteme und Kommunikationskulturen (Publizistik), Psycholinguistik.
Magisterarbeit: "Fälschungen im Journalismus. Determinanten und Formen von Erfindungen in redaktionellen Beiträgen."
Gutachter: Prof. Dr. Manfred Buchwald.
Studienfinanzierung:
Nachtzüge:
November 1995 bis August 1998: Schlaf- und Liegewagenbetreuer bei der Compagnie Int. de Wagons-Lits,
seit Juli 1999 bis 2003: Zugreiseleiter bei der RBG und der DB EuropeanRailservice.
Information:
September 1998 bis Juni 1999: Infostellenmitarbeiter bei der Berlin Tourismus Marketing.
Journalistische Jobs:
Radio:
November 1994 bis Mai 1995: 25 Moderationen beim Offenen Kanal Berlin;
Februar/März 1997: Praktikum bei JAM FM;
April 1997 bis Juli 1997: Redakteur und Moderator bei JAM FM .
Januar 2004 bis März 2004: Volontariatspraktikum in der RBB Sportredaktion (infoRADIO).
Fernsehen:
Mai 2004 bis Juli 2004: Volontariatspraktikum bei XXP (Spiegel TV Berlin).
Print:
März 1998 bis Mai 1999: Freier Autor für das "iq"-Magazin,Ressorts Gesellschaft, Musik, Sport;
März 2002: 2 Beiträge für Nullnummern des Wirtschaftsmagazins "Faktor" (keine Veröffentlichung - nur zur Werbeaquise);
seit Mai 2003: Kolumnist des t5-Journals, Rheinlad-Pfalz.
Online:
Seit September 1999: Autor beim "evolver" (Wien), evolver.at.
Fähigkeiten/ Interessen
Sprachen: Englisch, Italienisch, großes Latinum, kleines Graecum. (Durch die Arbeit im AutoZug International Konversationskenntnisse des Französischen und Niederländischen.) Journalismus: Hörfunkbeiträge mit digitalem Schnittplatzsystem produzieren, Selbstfahrerstudio. EDV: MS-Office, Photoshop, Dreamweaver. Bahn: Zugschaffner im Bahnbetriebsdienst.Qualifikation für ICE-Schnellfahrstrecken, Selbstrettungskonzept. Notfallausbildung durch DB Netz. Interessen: Medienfakes, Krisenkommunikation, Katastrophenanalyse im professionellen Sektor, Rockmusik, Fatalismus-Literatur, italienischer Fußball im privaten Sektor.
... link
... older stories




